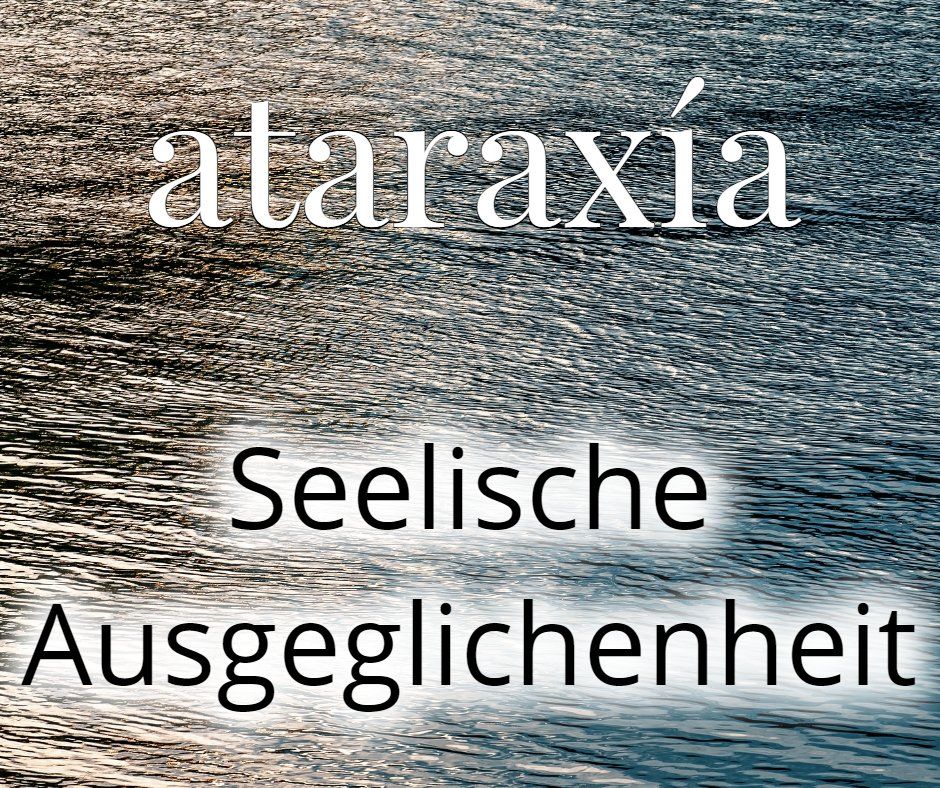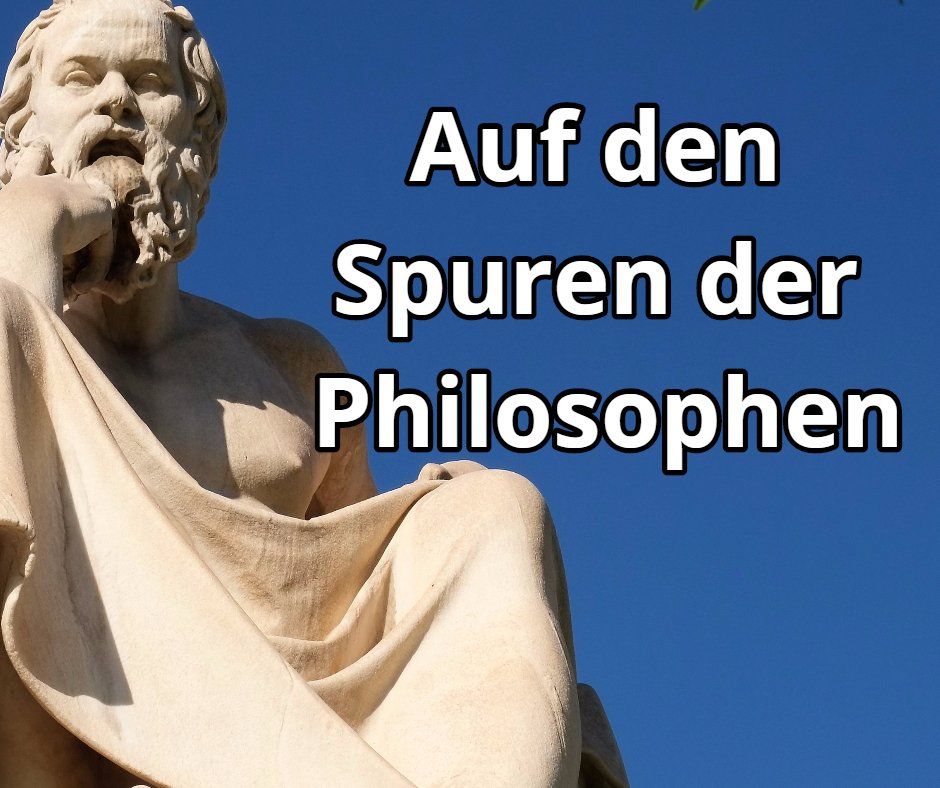Grand Tour, Bayern und das Erbe der Antike
Athen zur Zeit der Grand Tour
Im späten 18. und frühen 19. Jahrhundert war Athen eine verschlafene Provinzstadt im Osmanischen Reich – klein, mit nur wenigen tausend Einwohnern, aber geprägt von den eindrucksvollen Ruinen der Antike, die europäische Reisende magisch anzogen. Für die Osmanen galten diese Überreste meist als wertlose alte Steine, entsprechend locker war der Zugang: Gegen Bakschisch oder mit Empfehlungsschreiben erhielten westliche Besucher oft Zutritt zu den Stätten – und nicht selten die Erlaubnis, Skizzen anzufertigen, Vermessungen vorzunehmen oder sogar Artefakte mitzunehmen.

Louis-Francois Edward Cassas (1756-1827): The Temple of Olympian Zeus in 1787 in Ottoman Athens. © Bild: Wikimedia Commons
Die meist begüterten Reisenden waren selten allein unterwegs. Sie reisten in Gesellschaft von Künstlern, Architekten, Dienern und bewaffneten Begleitern, zeichneten und beschrieben die Ruinen und sahen es als ihre Aufgabe, das antike Erbe für die europäische Gelehrtenwelt zu dokumentieren. Systematische Ausgrabungen im modernen Sinne waren selten – weit häufiger gehörten Plünderungen und gezielte „Sammlungen“ von Artefakten zum Alltag.
„Athen bietet einen auffälligen Kontrast zwischen der Erhabenheit seiner Ruinen und der Schäbigkeit seiner modernen Behausungen. Die Häuser sind niedrig und schlecht gebaut, die Straßen eng, krumm und schmutzig.“
Edward Dodwell, A Classical Tour through Greece (1819)

James Stuart (1713-1788) and Nicholas Revett (1720-1804): The Gate of Athena Archegetis (11 BC) in Ottoman Athens in 1751. © Bild: Wikimedia Commons
Entscheidend für den Erfolg solcher Unternehmungen war die Zusammenarbeit mit lokalen Vermittlern: Dolmetscher, Dragomane und griechische Honoratioren öffneten Türen, organisierten Genehmigungen und sorgten für Schutz. Viele gebildete Griechen unterstützten die Reisenden und teilten deren Interesse an der Wiederentdeckung der eigenen antiken Vergangenheit. Das Verhältnis zur osmanischen Obrigkeit blieb aber ambivalent – mal von Gastfreundschaft geprägt, mal von Misstrauen, besonders als der griechische Unabhängigkeitskrieg näher rückte.

James Stuart & Nicholas Revett. The Antiquities of Athens measured and delineated by James Stuart F.R.S. and F.S.A. and Nicholas Revett Painters and Αrchitects. 1794. © Bild: Wikimedia Commons
„Die modernen Athener pflegen in den Ruinen nach Steinen zu graben, um ihre elenden Häuser zu bauen. …… Die Türken, die im Besitz dieser unschätzbaren Überreste der Antike sind, sind sich ihres Wertes völlig unbewusst und lassen es häufig mit brutalster Gleichgültigkeit zu, dass sie beschädigt oder zerstört werden.“
Sir William Gell, Itinerary of Greece (1810)
Zu den Intellektuellen, die im Rahmen dieser kulturellen Entdeckungsreisen nach Athen kamen, zählten bekannte Persönlichkeiten wie Lord Byron, Edward Dodwell und Charles Robert Cockerell. Byron, der britische Dichter und Philhellene, reiste nach Griechenland, um den Unabhängigkeitskampf zu unterstützen. Obwohl sein Wirken überwiegend politisch und literarisch motiviert war, setzte sein Beispiel Impulse für nachfolgende Generationen, die antike Kultur hautnah zu erleben. Dodwell, ein britischer Reiseschriftsteller und Antikekenner, verfasste detaillierte Berichte über Athen, die die Faszination europäischer Intellektueller für die antiken Ruinen verstärkten. Cockerell, ein britischer Architekt und Archäologe, dokumentierte die antiken Monumente und leistete mit seinen Studien und Zeichnungen einen wichtigen Beitrag zur Wiederbelebung der klassischen Baukunst. Diese Persönlichkeiten halfen dabei, Athen nicht nur als Ruinenhort, sondern auch als Symbol einer kulturellen und nationalen Wiedergeburt zu etablieren, wobei ihre Arbeiten das Interesse der europäischen Elite weckten und die Adaption antiker Ideale im 19. Jahrhundert förderten.

Johann Jakob Wolfensberger (1797–1850): The Acropolis of Athens between 1832 and 1835. © Bild: Wikimedia Commons
Ein Aspekt, der aber nicht unerwähnt bleiben sollte, ist der imperiale Kunstraub, der häufig unter dem Vorwand der „Antikenrettung“ betrieben wurde. Ein bekanntes Beispiel dafür ist der Parthenon: Zwischen 1801 und 1812 ließ Lord Elgin zahlreiche Skulpturen und Reliefs entfernen. Elgin, britischer Botschafter im Osmanischen Reich, nutzte seine politische Stellung, um Zugang zu den antiken Stätten Griechenlands zu erhalten, das damals unter osmanischer Herrschaft stand. Mit einer fragwürdigen Erlaubnis, sogenannte „Stücke von Steinen mit alten Inschriften oder Figuren“ zu entnehmen, ließ er bedeutende Teile des Parthenon-Frieses sowie Skulpturen und Bauteile anderer Akropolis-Bauten entfernen und nach England bringen. Diese Aktion wird heute als einer der ersten großen imperialen Kunstraube der westlichen Archäologie angesehen. Elgin rechtfertigte seine Handlungen als „Rettung der Antike“, doch viele sahen darin eine kulturelle Enteignung und eine unrechtmäßige Aneignung von nationalem Erbe. Dieses Vorgehen – vom Forschen und Zeichnen hin zur systematischen Demontage – markiert einen Wendepunkt in der westlichen Wahrnehmung von antiken Monumenten und wirft bis heute die Frage auf: Wem gehört das kulturelle Erbe?

James Stuart (1713-1788) and Nicholas Revett (1720-1804): The monument of Philopappus in Athens in 1751. © Bild: Wikimedia Commons
Der Einfluss der Grand Tour auf die europäische Architektur
Die Grand Tour prägte das europäische Architekturverständnis im 18. und frühen 19. Jahrhundert nachhaltig. Wohlhabende Reisende und Künstler besuchten antike Stätten in Italien und Griechenland und brachten Skizzen, Berichte und eine neue Begeisterung für die klassische Antike mit nach Europa. Dieser Einfluss führte zur Errichtung zahlreicher Bauwerke, die sich an griechisch-römischen Vorbildern orientierten. Ein Beispiel dafür ist das British Museum in London (ab 1823), dessen klassizistische Fassade an einen griechischen Tempel erinnert und die wachsende Antikenbegeisterung Großbritanniens widerspiegelt. Ebenso steht die Kirche La Madeleine in Paris (1807–1842) als monumentaler Tempelbau für den Einfluss antiker Architektur. In Bayern ließ König Ludwig I. die Walhalla bei Regensburg (1830–1842) errichten – eine Ruhmeshalle nach dem Vorbild des Parthenon in Athen. Auch das Alte Museum in Berlin (1825–1830) von Karl Friedrich Schinkel greift die klare Formsprache der Antike auf und setzt sie als moderner Museumsbau um.

Der Theseustempel im Wiener Volksgarten ist ein klassizistisches Bauwerk und eine verkleinerte Nachbildung des antiken Hephaisteions in Athen. Er wurde im Auftrag von Kaiser Franz I. nach Plänen des Architekten Peter von Nobile zwischen 1819 und 1823 errichtet. Nobile war nie selbst in Griechenland, sondern ließ sich von zeitgenössischen Studien, Zeichnungen und Reiseberichten über die antike Architektur inspirieren. Besonders Werke von Archäologen und Künstlern der Grand Tour prägten seine Entwürfe. Der Tempel wurde somit nicht als exakte Nachbildung des Hephaisteions entworfen, sondern als eine klassizistische Hommage an das antike Vorbild, wobei Nobile die antiken Prinzipien der Dorischen Ordnung aufgriff, um ein Monument zu schaffen, das sowohl den klassischen Idealen als auch den Bedürfnissen der Zeit entsprach. © Bild: Gugerell Wikimedia Commons
Die Rolle der Bayern und die Neugründung Athens
Mit der Gründung des modernen Griechenlands im Jahr 1830 und der Wahl von Otto von Bayern zum ersten König des neuen Staates 1832 begann eine neue Phase in der Geschichte Athens. König Otto war ein bayerischer Prinz, und mit ihm kamen viele bayerische Beamte, Architekten und Wissenschaftler nach Griechenland. Athen wurde zur neuen Hauptstadt des modernen Griechenlands ernannt, und die bayerische Herrschaft spielte eine zentrale Rolle in der Neugestaltung der Stadt. Ziel war es, Athen als das kulturelle Zentrum einer neuen Nation zu etablieren, das sich auf seine antiken Wurzeln stützen konnte.

Peter von Hess (1792–1871): Empfang König Ottos von Griechenland in Athen. 1839. © Bild: Wikimedia Commons
Unter der bayerischen Regentschaft wurde die „antike“ Dimension Athens bewusst inszeniert. Der Stadtumbau Athens und die Einführung neoklassizistischer Architektur waren Ausdruck eines politischen Projekts, das sich die Verbindung zwischen der antiken Pracht und der modernen griechischen Identität auf die Fahnen schrieb. Unter der Leitung von Leo von Klenze, dem Architekten von König Ludwig I. von Bayern, wurden zentrale Bauprojekte in Angriff genommen, die das Bild von Athen als „neues Rom“ formen sollten. Gleichzeitig begannen die archäologischen Ausgrabungen unter Ludwig Ross, dem ersten Direktor des griechischen Archäologischen Dienstes, die antiken Relikte systematisch zu dokumentieren und teilweise zu konservieren.
„Die Erhaltung und Freilegung der Monumente Athens ist Pflicht eines Staates, der sich als Erbe des alten Hellas betrachtet.“
Ludwig Ross, Reisen auf den Griechischen Inseln des Ägäischen Meeres (1840)

Die Akademie von Athen ist das prächtigste Bauwerk der Athener Trilogie – einem beeindruckenden Ensemble neoklassizistischer Gebäude im Herzen der Stadt, zu dem außerdem die Nationalbibliothek und die Universität Athen gehören. Entworfen vom dänischen Architekten Theophil Hansen und 1887 vollendet, orientiert sich die Akademie stilistisch an der antiken griechischen Architektur. Besonders eindrucksvoll sind die reich verzierten Säulen, gekrönt von den Statuen der Götter Athena und Apollon, sowie die monumentalen Figuren von Platon und Sokrates, die den Eingang säumen. Thomas Wolf, www.foto-tw.de: Akademie von Athen © Bild: Wikimedia Commons
Unter der bayerischen Herrschaft wurde Athen gezielt zum politischen Symbol und Instrument der nationalen Wiedergeburt Griechenlands geformt. Die neoklassizistische Architektur und die Bewahrung antiker Monumente dienten einer Ideologie, die Athen als kulturelles Zentrum des modernen Griechenlands etablieren sollte. Der Rückgriff auf die Antike war dabei nicht nur Ausdruck der Wertschätzung des kulturellen Erbes, sondern auch ein Akt politischer Selbstinszenierung.
Antike Ruinen und Monumente wurden bewusst als sichtbare Zeichen der glorreichen Vergangenheit inszeniert, um die nationale Identität zu stärken und Griechenlands Bedeutung innerhalb Europas zu betonen. Gleichzeitig entstand das Bild Athens als „ewige“ Stadt, die die Werte von Demokratie und Freiheit verkörpert – im Einklang mit den politischen Zielen der bayerischen Krone.
BILDNACHWEIS:
- Peter von Hess (1792–1871): Empfang König Ottos von Griechenland in Athen. 1839. © Bild: Wikimedia Commons
- Thomas Wolf, www.foto-tw.de: Akademie von Athen, Griechenland. © Bild: Wikimedia Commons
- James Stuart & Nicholas Revett. The Antiquities of Athens measured and delineated by James Stuart F.R.S. and F.S.A. and Nicholas Revett Painters and Αrchitects. 1794. © Bild: Wikimedia Commons
- Johann Jakob Wolfensberger (1797–1850): The Acropolis of Athens between 1832 and 1835. © Bild: Wikimedia Commons
- Louis-Francois Edward Cassas (1756-1827): The Temple of Olympian Zeus in 1787 in Ottoman Athens. . © Bild: Wikimedia Commons
- James Stuart (1713-1788) and Nicholas Revett (1720-1804): The monument of Philopappus in Athens in 1751. © Bild: Wikimedia Commons
- James Stuart (1713-1788) and Nicholas Revett (1720-1804): The Gate of Athena Archegetis (11 BC) in Ottoman Athens in 1751. © Bild: Wikimedia Commons
- Ippolito Caffi (1809–1866): The Partenon etwa 1863. © Bild: Wikimedia Commons
- Gugerell: Volksgarten in Wien 1, Theseustempel. © Bild: Wikimedia Commons
BUCHEMPFEHLUNGEN
- Reinhold Friedrich: König Otto von Griechenland: Die bayerische Regentschaft in Nauplia. Allitera (2015)
- Hans-Bernhard Schlumm: Deutsche Spuren in Griechenland: Der Beitrag der deutschen Einwanderung im 19. Jahrhundert zur Entwicklung Griechenlands. Verlag der Griechenland Zeitung (2018)
- Ludwig Ross (Hrsg): Reisen des Königs Otto und der Königinn Amalia in Griechenland.
- Richard Schuberth: Lord Byrons letzte Fahrt: Eine Geschichte des Griechischen Unabhängigkeitskrieges. Wallstein ( 2021)
- Patrick Schollmeyer: Die 40 bekanntesten archäologischen Stätten in Athen und Attika. Nünnerich-Asmus (2019)
- Ancient Agora of Athens – Areopagus Hill. Brief history and tour. Publication of the Association of Friends of the Acropolis. (2004)
- Ulrich Sinn: Athen – Geschichte und Archäologie. Beck (2004)
- Karl W. Welwei: Das klassische Athen. Demokratie und Machtpolitik im 5. und 4. Jahrhundert. WBG (1999)
- Karl W. Welwei: Athen. Vom neolithischen Siedlungsplatz zur archaischen Großpolis: Vom neolithischen Siedlungsplatz zur archaischen Grosspolis. WBG (2001)
- Heiner Knell: Vom Parthenon zum Pantheon- Meilensteine antiker Architektur: Meilensteine der antiken Architektur. Philipp von Zabern (2013)
- Heiner Knell: Athen im 4. Jahrhundert v. Chr. - eine Stadt verändert ihr Gesicht: Archäologisch-kulturgeschichtliche Betrachtungen. WBG (2000)
- Christian Meier: Athen: Ein Neubeginn der Weltgeschichte. Pantheon (2012)
- Christian Habicht: Athen: Die Geschichte der Stadt in hellenistischer Zeit. Beck (1995)
- Jutta Stroszeck u. Andrea Schellinger: »... in einer Ruhe die wundernimmt«: Der Kerameikos in literarischen Zeugnissen von 1863 bis heute. Kadmos (2017)
- Jutta Stroszek: Der Kerameikos in Athen: Geschichte, Bauten und Denkmäler im archäologischen Park. Bibliopolis (2014)
- Renate Tölle-Kastenbein: Das archaische Wasserleitungsnetz für Athen und seine späteren Bauphasen. WBG (1994)
- Renate Tölle-Kastenbein: Das Olympeion in Athen. Böhlau (1994)
- Gottfried Gruben u.a.: Die Heiligtümer und Tempel der Griechen. Hirmer (2001)
- Savas Gogos u.a.: Das Dionysostheater von Athen: Architektonische Gestalt und Funktion. Phoibos (2008)
- Emil Reisch und Wilhelm Dörpfeld: Das griechische Theater: Beiträge zur Geschichte des Dionysostheaters in Athen und anderer griechischer Theater. Hansebooks (2019)
- Adolf Boetticher: Die Akropolis von Athen. Springer (2013)
- Christoph Höcker und Lambert Schneider: Die Akropolis von Athen: Eine Kunst- und Kulturgeschichte. WBG (2001)
- John McK. Camp II u. Craig A. Mauzy (Hrsg.): Die Agora von Athen: Neue Perspektiven für eine archäologische Stätte. Philipp von Zabern (2009)
- Hans Rupprecht Goette u. Jürgen Hammerstaedt: Das antike Athen: Ein literarischer Stadtführer. C.H.Beck (2012)
- Klaus Gallas: Reclams Städteführer Athen: Architektur und Kunst (2019)
- Peter Connolly u. Hazel Dodge: Die antike Stadt. Das Leben in Athen und Rom. Könemann (1998)
- Frank Börner: Die bauliche Entwicklung Athens als Handelsplatz in archaischer und klassischer Zeit (Quellen und Forschungen zur Antiken Welt). Tuduv (1996)
- Heiner Knell: Athen im 4. Jahrhundert v. Chr. - eine Stadt verändert ihr Gesicht. WBG (2000)
- Frank Kolb: Agora und Theater, Volks- und Festversammlung - Archäologische Forschungen, Band 9. (1981)
- Christian Meier: Athen: Ein Neubeginn der Weltgeschichte. Pantheon (2012)
- Leonhard Burckhardt u. Jürgen Ungern-Sternberg (Hrsg.): Große Prozesse im antiken Athen. C.H.Beck (2000)
- Peter Funke: Athen in klassischer Zeit (Beck'sche Reihe 2074). C.H.Beck (2019)
- Dorothy B. Thompson: An Ancient Shopping Center (Agora Picture Book 12). American School of Classical Studies at Athens (2001)
- Laura Gawlinski: Athenian Agora (Museum Guides). American School of Classical Studies at Athens (2014)
- Susan I. Rotroff , Robert D. Lamberton: Women in the Athenian Agora (Agora Picture Book, Band 26). American School of Classical Studies at Athens (2006)
- Alison Frantz: The Middle Ages in the Athenian Agora (Agora Picture Book 7). American School of Classical Studies (1961)
- Wilfried Nippel: Antike oder moderne Freiheit: Die Begründung der Demokratie in Athen und in der Neuzeit. Fischer (2008)
- Karl-Wilhelm Welwei: Das Klassische Athen. Demokratie und Machtpolitik im 5. und 4. Jahrhundert. Primus (2001)