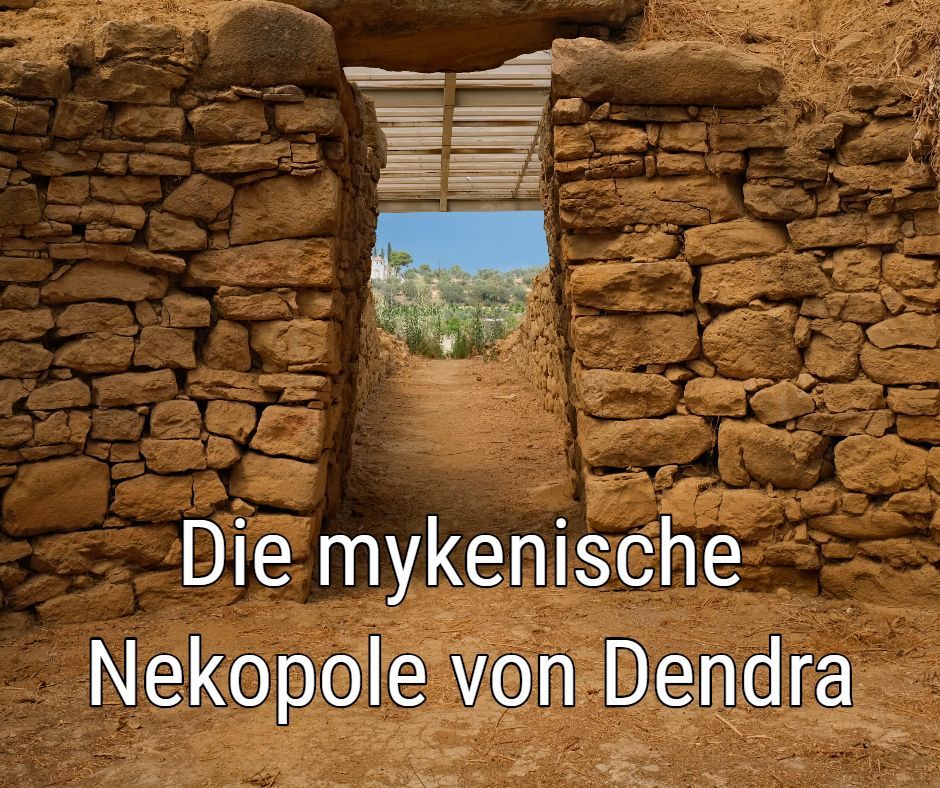Mykene
Mykene zählt zu den bedeutendsten archäologischen Fundorten des bronzezeitlichen Griechenlands und ist der Namensgeber der sogenannten mykenischen Palastkultur. Bereits im 16. Jahrhundert v. Chr. lassen sich hier komplexe soziale Strukturen nachweisen, die sich später in einer monumentalen Palastanlage manifestierten. Auch wenn nicht abschließend geklärt ist, welche Residenz als erste im Sinne einer ausgebildeten Palastarchitektur zu gelten hat, sprechen zahlreiche Befunde dafür, Mykene als ein zentrales politisches und kulturelles Machtzentrum innerhalb der spätbronzezeitlichen mykenischen Koine zu betrachten – einer überregionalen, durch gemeinsame administrative, architektonische und ideologische Merkmale gekennzeichneten Kulturzone. Die Wiederentdeckung der Stätte durch Heinrich Schliemann im 19. Jahrhundert markiert zudem einen Wendepunkt in der Geschichte der archäologischen Forschung.

Zur Blütezeit der Grand Tour war das bronzezeitliche Griechenland archäologisch und kulturhistorisch kaum erschlossen. Frühe Reisende - wie etwa einige Mitglieder der „Society of Dilettanti“ - sahen daher in den Ruinen von Mykene vor allem pittoreske Überreste einer dunklen Vorzeit. Ein tieferes Verständnis für die Bedeutung der Stätte fehlte – nicht zuletzt, weil systematische Grabungen noch ausstanden. Erst mit Heinrich Schliemanns Ausgrabungen ab 1876, insbesondere der Freilegung der Schachtgräber und ihrer reichen Beigaben, rückte Mykene ins Zentrum des archäologischen Interesses – und verlieh der homerischen Welt erstmals greifbare Gestalt. [ mehr….]
Die archäologische Stätte von Mykene nimmt eine Schlüsselstellung in der Erforschung der spätbronzezeitlichen Kulturen des griechischen Festlands ein. Bereits ab dem 16. Jahrhundert v. Chr. lassen sich hier soziale Differenzierung und Elitenbildung fassen – sichtbar etwa in den berühmten Schachtgräbern innerhalb der Akropolis. Die monumentale Palastarchitektur mit Megaron, Zyklopenmauern und Löwentor entstand im 14. Jahrhundert v. Chr. und spiegelt die politische und wirtschaftliche Bedeutung der Stadt wider. Auch wenn nicht mit letzter Sicherheit bestimmt werden kann, welche der mykenischen Residenzen chronologisch die erste war, gilt Mykene als prägendes Zentrum einer neuen Form von Herrschaft und Gesellschaft. Die Wiederentdeckung durch Heinrich Schliemann im Jahr 1876 markiert darüber hinaus den Beginn einer neuen Ära der Mittelmeerarchäologie – und den Auftakt einer bis heute andauernden Faszination für das bronzezeitliche Griechenland.

Vor nahezu 150 Jahren unternahm Heinrich Schliemann, der als „Vater der mykenischen Archäologie“ gilt, den Versuch, in der Ruinenstadt Mykene das Grab des legendären Königs Agamemnon zu finden. Im Gegensatz zu anderen Wissenschaftlern begann Schliemann seine Ausgrabungen innerhalb der Stadtmauern und stieß dort rasch auf bedeutende Funde. Unter anderem entdeckte er im Gräberrund A mehrere Schachtgräber mit wertvollen Beigaben, darunter die berühmte Goldmaske. Schliemann vermutete, dass diese Funde Agamemnon gehörten, doch spätere Forschungen ergaben, dass die Gräber etwa 300 bis 400 Jahre älter waren als die vermutete Zeit des Trojanischen Krieges und somit nicht mit Agamemnon in Verbindung stehen können. Dennoch waren Schliemanns Entdeckungen von herausragender Bedeutung. Sie machten Mykene zur Wiege der ersten bekannten Hochkultur des europäischen Festlands. Die Goldmaske des Agamemnon wurde zu einem der bekanntesten Artefakte der mykenischen Zeit, und das Löwentor avancierte zu einem der beliebtesten Fotomotive Griechenlands. © Bild: Wikimedia Commons
Mykene präsentiert sich dem heutigen Besucher mit einer Vielzahl beeindruckender Relikte aus der mykenischen Zeit. Der Rundgang beginnt am Löwentor, dem Hauptzugang zur befestigten Oberstadt, das mit seinem Relief die älteste Monumentalplastik Europas darstellt. Innerhalb der Mauern befinden sich der Palastkomplex mit dem Megaron sowie das Gräberrund A, ein doppelter Plattenring, in dem Heinrich Schliemann 1876 die sechs Schachtgräber mit der sogenannten Goldmaske des Agamemnon fand. Außerhalb der Stadtmauern befinden sich weitere bedeutende Gräber wie das Gräberrund B sowie das Grab des Aigisthos, das Grab der Klytaimnestra und das Löwengrab. Die Unterstadt, insbesondere das Viertel des Ölhändlers, gibt Aufschluss über das alltägliche Leben der damaligen Zeit. Etwa 1 Kilometer nordwestlich der Stadt befindet sich das Schatzhaus des Atreus, ein beeindruckendes Kuppelgrab mit monumentaler Architektur.
Die zyklopischen Ringmauern

In der Mitte des 14. Jahrhunderts v. Chr. erhielt Mykene seinen ersten Befestigungsring. Die Fläche, die von dieser „zyklopischen“ Befestigungsmauer umschlossen wurde, umfasste damals nur den nördlichen Vorsprung des Hügels. Der Gräberkreis A war noch nicht einbezogen. Das Haupttor befand sich etwas nördlich von der Stelle, an der in späterer Zeit das Löwentor errichtet wurde. In der Zeit der größten Blüte von Mykene (Mitte des 13. Jahrhunderts v. Chr.) schuf dann ein mächtiger Herrscher eine Reihe monumentaler Werke. Damals wurde auch das Löwentor mit seiner Bastion wie auch die Südmauer errichtet. Ebenso wurden die Südostbastion und das Nordtor gebaut und die große Rampe angelegt, die zum Palast führt. In der letzten Bauphase (um 1200 v. Chr.) wurde die Zitadelle nochmals erweitert. Innerhalb dieser Mauern legte man eine unterirdische Zisterne an, die die Wasserversorgung sichern sollte. (Dazu auch: Die Geschichte von Mykene)
Die Burgmauern von Mykene sind nahezu vollständig erhalten, erstrecken sich über eine Gesamtlänge von etwa 900 Metern und umschließen eine Fläche von rund 30.000 Quadratmetern. Ein Großteil des Mauerwerks besteht aus riesigen, grob behauenen Steinblöcken unterschiedlicher Größe, die ohne Verwendung von Mörtel in annähernd waagerechten Schichten aufgeschichtet wurden. Diese Bauweise wird als Zyklopenmauerwerk bezeichnet, benannt nach den Kyklopen der griechischen Mythologie – riesigen Wesen, denen die Errichtung solcher monumentalen Strukturen zugeschrieben wurde. Der Begriff reflektiert die antike Vorstellung, dass nur übermenschliche Kräfte in der Lage gewesen wären, derart massive Bauwerke zu errichten.
Das charakteristische „zyklopische“ Mauerwerk von Mykene weist eine Breite von etwa 5,5 bis 7,5 Metern auf, an einigen Stellen sogar bis zu 8 Meter. Die ursprüngliche Höhe der Mauern ist nicht exakt bekannt, man schätzt jedoch, dass sie mehr als 9 Meter betragen haben könnte. Die heutige Befestigungsmauer ist das Ergebnis mehrerer Bauphasen sowie späterer Reparaturen – etwa in hellenistischer Zeit – und Restaurierungen im 19. und 20. Jahrhundert. Einige Abschnitte waren bis zu den ersten Ausgrabungen verschüttet oder eingestürzt.
Das Löwentor
Der Eingang zur Burg von Mykene wird durch ein monumentales Tor markiert, das aus dem 13. Jahrhundert v. Chr. stammt. Seinen Namen – Löwentor – erhielt es aufgrund eines Reliefs, das das Entlastungsdreieck über dem Türsturz ziert. Es zeigt zwei einander symmetrisch gegenüberstehende Raubtiere, vermutlich Löwen, deren Vorderpfoten auf einer erhöhten Basis ruhen. Über dieser erhebt sich eine sich verjüngende Säule, ein Symbol für die Macht des Palastes. Das Tor liegt am Ende einer breiten Straße, die von der Unterstadt zur Akropolis führt. Der Weg steigt allmählich an und verengt sich zunehmend, sodass er in einem schmalen Durchgang endet, an dessen Ende das Tor errichtet wurde. Diese bauliche Gestaltung zwang Angreifer dazu, ihre Formation aufzulösen, und machte sie gleichzeitig angreifbar für die Verteidiger, die sie von mehreren Seiten aus unter Beschuss nehmen konnten. Die rechteckige Toröffnung wird von zwei gewaltigen, aufrecht stehenden Monolithblöcken flankiert und von einem massiven Türsturz überdeckt. Darüber liegt ein dreieckiger Entlastungsraum, in den das berühmte Löwenrelief eingelassen ist. Die Öffnung selbst misst etwa 3,10 Meter in der Höhe und 3 Meter in der Breite.

Der Burghof hinter dem Löwentor

Die große Rampe, die vom Löwentor zum Palast führt, wurde ebenfalls in der Mitte des 13. Jhs. v. Chr. angelegt.

Sobald man des Löwentor durchschritten hat, befindet sich zur rechten Hand ein Gebäude, das als Getreidespeicher interpretiert wird. Das ehemals zweigeschoßige Gebäude erhielt seinen Namen von den Getreidesamen, die in seinen Kellerräumen gelagert und dort verkohlt aufgefunden wurden.

Die Westerweiterung der Mauer mit dem Gräberrund A, dem Getreidespeicher und der großen Rampe. © Bild: Wikimedia Commons
Das Gräberrund A
Westlich der großen Rampe, etwa 20 Meter vom berühmten Löwentor entfernt, erstreckt sich eine kreisförmige Umfassungsmauer, die aus zwei konzentrischen Reihen aufrecht stehender Steinplatten besteht. Innerhalb dieses Gräberkreises wurden sechs Schachtgräber freigelegt, in denen insgesamt 19 Verstorbene bestattet waren. Die Gräber haben die Form großer rechteckiger Schächte. Die Maße reichen dabei vom kleinsten Grab mit 3 × 3,50 Metern bis zum größten mit 4,50 × 6,40 Metern. Die Tiefe variiert zwischen 1 und 4 Metern. Die Seiten der Schächte waren mit sorgfältig gesetzten Bruchsteinmauern ausgekleidet. Die Grabkammern wurden mit großen Steinplatten, meist aus Kalkstein oder Schiefer, abgedeckt. Darüber legte man eine Schutzschicht aus Erde oder Lehm, um die Gräber zu versiegeln. Der restliche Hohlraum wurde mit Erde aufgefüllt. Ursprünglich lag der Gräberkreis außerhalb der mykenischen Palastanlage. Im Zuge einer späteren Erweiterung der Burgmauer im 13. Jahrhundert v. Chr. wurde das Areal mitsamt der Gräber und dem nahegelegenen Kultzentrum in den ummauerten Bereich integriert. Dazu wurden Terrassierungen vorgenommen, das Gelände aufgeschüttet und die über den Gräbern stehenden Grabstelen höher gesetzt. Der heute sichtbare Plattenring wurde ebenfalls in dieser Umbauphase angelegt.
Das Kultzentrum

Im südlichen Bereich der mykenischen Akropolis, entlang einer Straße, die an der Innenseite der Befestigungsmauer verläuft, befindet sich das sogenannte Kultzentrum von Mykene. In diesem Bereich wurden mehrere Gebäude ausgegraben, deren Architektur und Ausstattung – darunter Altäre, Wandmalereien und rituelle Objekte – darauf hindeuten, dass hier verschiedene Formen religiöser oder kultischer Handlungen stattfanden. Die Funde deuten auf eine bedeutende kultische Nutzung des Areals während der späten Palastzeit hin.
Das Megaron des mykenischen Palastes

Der Palastkomplex dominiert den Gipfel des Burghügels.

Der zentrale Raum des mykenischen Palastkomplexes – das sogenannte Megaron – war in drei aufeinanderfolgende Bereiche gegliedert: eine Vorhalle, einen Vorraum und den eigentlichen Thronsaal. Diese Raumfolge ist charakteristisch für mykenische Paläste und erinnert in ihrer Struktur an die Beschreibungen von Herrscherresidenzen in der homerischen Dichtung. Im Hauptraum befanden sich eine große runde Herdstelle und der Thron des Herrschers (wa-na-ka). Die Fundamente der vier Säulen, die einst die Dachkonstruktion über der Herdstelle trugen, sind noch heute sichtbar. Die Wände des Thronsaals waren mit aufwendigen Wandmalereien geschmückt, von denen sich nur wenige Fragmente erhalten haben. Ein kunstvoll verlegter Gipsboden zeugt ebenfalls vom Repräsentationsanspruch der Anlage.
Das steingraue Bild, das sich heutigen Besuchern von dem legendären Palast der mykenischen Könige bietet.

Die wiederhergestellte Südostecke des Königspalastes.
Gebäude im östlichen Palastbereich
Im östlichen Teil des mykenischen Palastkomplexes wurden mehrere bedeutende Gebäude freigelegt. Dazu gehört das sogenannte „Haus der Säulen“, benannt nach einer Kolonnade in seinem zentralen Innenhof. Ebenfalls entdeckt wurde ein megaronförmiger Bau mit einer tiefer gelegenen Vorratskammer sowie die sogenannte „Werkstatt der Künstler“, in der zahlreiche Rohmaterialien und halbfertige Gegenstände gefunden wurden. Diese Gebäude stammen aus der späten Palastzeit und wurden vor allem in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts v. Chr. genutzt.
Die unterirdische Zisterne
In der letzten Bauphase der mykenischen Burganlage um 1200 v. Chr. wurde der nordöstliche Bereich nochmals erweitert und mit zusätzlichen Befestigungen gesichert. Innerhalb dieses neu geschützten Areals legte man eine unterirdische Zisterne an, die die Wasserversorgung der Festung auch im Belagerungsfall sicherstellen sollte. Sie zählt zu den bedeutenden technischen Leistungen der mykenischen Architektur. Die Anlage wurde in eine natürliche Felsspalte eingebaut und liegt etwa 18 Meter unter dem heutigen Bodenniveau. Ein Zugangsschacht mit Treppe führt zu einem Tunnel, durch den Wasser aus einer Quelle außerhalb der Befestigung ins Innere geleitet wurde.
Das Nordtor
Das Nordtor von Mykene ist eine Nachahmung des berühmten Löwentors, allerdings in kleinerem Maßstab. Es wurde in einen Rücksprung der frühen zyklopischen Mauer eingelassen, die ursprünglich zur ersten Bauphase der Befestigungsanlage gehörte. Das Tor hat eine Länge von 6,5 Metern und eine Breite von 3,3 Metern.
Wohnhäuser und "Schatzhäuser"
In unmittelbarer Nähe der Burg finden sich weitere bedeutende Monumente. Dazu gehört ein Komplex von Wohnhäusern der Mykener, die außerhalb der Befestigungsanlage lebten. Darüber hinaus gibt es mehrere Gräber, die in der Umgebung der Burg verteilt sind und aus verschiedenen Epochen stammen. Einige dieser mykenischen Tholosgräber enthalten reiche Grabbeigaben, weshalb sie bald als „Schatzhäuser“ bezeichnet wurden. Man nahm irrtümlich an, dass es sich um die Schatzkammern der mythischen Könige handelte, wie sie in den Erzählungen Homers beschrieben werden.
Das Gräberrund B
Der Gräberkreis B ist älter als der Gräberkreis A und stammt aus der frühen mykenischen Zeit (ca. 1600–1500 v. Chr.). Hier wurden 14 Schachtgräber und 10 Kistengräber entdeckt, in denen schätzungsweise etwa 40 Verstorbene ihre letzte Ruhestätte fanden. Die Umfassungsmauer des Gräberkreises ist in der frühen zyklopischen Mauertechnik gebaut und hat einen ähnlichen, aber etwas kleineren Durchmesser als der Gräberkreis A. Die Schachtgräber sind kleiner und weniger tief als die des Gräberkreises A, und die Grabbeigaben sind weniger spektakulär als die, die Heinrich Schliemann im Gräberkreis A fand. Gräberkreis B: (© Bild: Wikimedia Commons, Grave circle B: © Bild: Wikimedia Commons)
Das Viertel des Ölhändlers
Südlich des Gräberrundes B befindet sich ein Komplex aus Gebäuden und Werkstätten, der auf das 13. Jahrhundert v. Chr. datiert wird. Dieser Bereich ist als 'Viertel des Ölhändlers' bekannt, da Pithoi zur Lagerung von Öl gefunden wurden. Das nördliche Gebäude, das 'Haus der Schilde', erhielt seinen Namen durch Elfenbeintäfelchen, auf denen Schilde abgebildet sind. Das mittlere Gebäude wurde als 'Haus des Ölhändlers' bezeichnet, aufgrund der Funde von Pithoi, die für die Lagerung von Öl genutzt wurden. Im 'Haus der Sphingen' entdeckte man Elfenbeinplättchen mit reliefierten Darstellungen von Sphingen. Das 'Westhaus' besteht aus einer Reihe von Räumen sowie einem megaronartigen Bau, der vermutlich eine zeremonielle oder gesellschaftliche Funktion hatte.
Das Grab des Aigisthos
Das um 1500 v. Chr. errichtete Grab des Aigisthos gilt als eines der ältesten Kuppelgräber von Mykene. Benannt wurde es nach dem aus der griechischen Mythologie bekannten Aigisthos, dem Geliebten der Klytaimnestra. Es hat einen langen, aber schmalen Dromos. Die Länge des in den Lehmboden und den darunter liegenden Fels gegrabenen Dromos beträgt 22 m, die Breite ca. 5 m. Um den Teil der Seitenwände, der nur aus Lehm bestand, zu stabilisieren, wurden Mauern aus groben Feldsteinen errichtet. Ursprünglich bestand die Fassade aus grob behauenen Steinen. In späterer Zeit errichtete man davor eine verzierte Fassade aus Poros und Mandelstein. Von der ursprünglichen Porosfassade sind heute nur noch Fragmente des östlichen Teils erhalten. Zum Bau der als Trockenmauerwerk errichteten Kuppel wurde ein Loch in den Fels geschlagen. Sie hat einen Durchmesser von 14 m und eine ursprüngliche Höhe von ca. 13 m. Das Grab enthielt nur einen Grabschacht in der Nähe des Eingangs. Um 1250 v. Chr. wurde das Grab aufgegeben und auch ausgeraubt. In späterer Zeit stürzte die Kuppel ein.
Das Grab der Klytaimnestra
Das Grab der Klytaimnestra ist das jüngste Tholosgrab von Mykene. Es wurde wohl um 1220 v. Chr. errichtet und nach Klytaimnestra benannt, der Gattin Agamemnons, des Anführers der Griechen im Trojanischen Krieg. Heinrich Schliemann nannte das Grab „Schatzhaus beim Löwentor“, da es sich in der Nähe des Löwentors befindet. Der Dromos des Grabes, der mit rechteckigen Konglomeratsteinen verkleidet ist, hat eine Länge von 37 m und eine Breite von 6 m. Der Eingang misst 5,60 m in der Höhe und etwa 2,5 m in der Breite. Über dem Tor befindet sich ein Entlastungsdreieck. Die Kuppel des Grabes hat einen Durchmesser von 13,5 m. In der hellenistischen Zeit wurde das Grab zugeschüttet, und auf ihm wurde ein Theater erbaut.
Das Löwengrab
Das Löwengrab, das nach dem sich in unmittelbarer Nähe befindlichen Löwentor benannt wurde, stammt aus der Zeit um 1450 v. Chr. Der Dromos hat eine Länge von 22 m und ist 5,40 m breit. Die aus exakt behauenen Konglomeratquadern errichtete Eingangspassage ist 5,40 m hoch, 5 m lang und 2,60 m breit. Vier monumentale Decksteine aus Konglomerat bildeten ursprünglich die Decke dieses monumentalen Eingangs. Drei davon sind noch heute an Ort und Stelle. Es ist ziemlich wahrscheinlich, dass es darüber ein Entlastungsdreieck gab. Sicher ist, dass das Grab mittels einer großen Holztür verschlossen werden konnte. Die inzwischen eingestürzte Kuppel hatte einen Durchmesser von etwa 14 m.
Das Schatzhaus des Atreus
Das Schatzhaus des Atreus (bzw. das Grab des Agamemnon), das glänzendste Monument der mykenischen Grabarchitektur, befindet sich am Ostabhang des Panagitsa-Hügels. Dieser unterirdische Tholosbau wurde zur selben Zeit wie das Löwentor, also um 1250 v. Chr., errichtet. Hierfür wurde ein riesiger Graben für die Anlage des Dromos sowie auch für die Kuppel aus dem Fels gehauen. Danach errichtete man die gigantische Kuppel aus geglätteten, in horizontalen Lagen verlegten Mandelsteinquadern. Dann bedeckte man den Kuppelbau zunächst mit Felsbrocken und schließlich mit Erde. Der Dromos hat eine Länge von 36 m und eine Breite von 6 m. Die Seiten des Dromos sind mit behauenen Konglomeratsteinblöcken verkleidet, die alle etwa die gleichen Maße haben. Die Schichten der Steine binden sich harmonisch in die monumentale Fassade ein, die eine Höhe von etwas mehr als 10 m erreicht. Das Eingangstor, das ursprünglich von zwei Halbsäulen flankiert war, hatte eine Höhe von 5,40 m und war ca. 2,5 m breit. Über dem Türsturz gibt es ein Entlastungsdreieck, das möglicherweise mit marmorierten Deckplatten versehen war.
BILDNACHWEIS
- Mykene: Überblick über die Stadt. Andreas Trepte. © Bild: Wikimedia Commons
- Xuan Che: The mask of Agamemnon. © Bild: Wikimedia Commons
- Grabring A in Mykene: Andreas Trepte. © Bild: Wikimedia Commons
- Gräberkreis B: Szigligeti Kalüpszó. © Bild:Wikimedia Commons
- Grave circle B: Davide Maure. © Bild: Wikimedia CommonsText

Suchbegriff bei Google Maps:
BUCHEMPFEHLUNGEN
- Josef Fischer: Mykenische Paläste: Kunst und Kultur. Philipp von Zabern (2017)
- J. Lessley Fitton: Die Minoer. Theiss (2004)
- Zeit der Helden: die "dunklen Jahrhunderte" Griechenlands 1200 - 700 v. Chr. Badisches Landesmuseum Karlsruhe. Primus (2008)
- Götter und Helden der Bronzezeit. Europa im Zeitalter des Odysseus. Bonn: Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland (1999)
- Richard T. Neer: Kunst und Archäologie der griechischen Welt: Von den Anfängen bis zum Hellenismus. Philipp von Zabern (2013)
- Katarina Horst u.a.: Mykene. Die sagenhafte Welt des Agamemnon. Philipp von Zabern (2018)
- George E. Mylonas: Mykene. Ein Führer zu seinen Ruinen und seine Geschichte. Ekdotike Athenon ( 1993)
- Ingo Pini: Beiträge zur minoischen Gräberkunde. Deutsches Archäologisches Institut (1968)
- Hans Günter Buchholz: Ägäische Bronzezeit. Wissenschaftliche Buchgesellschaft (1987)
- Heinrich Schliemann: Bericht über meine Forschungen und Entdeckungen. Fachbuchverlag Dresden (2019)
- Mykene: Die sagenhafte Welt des Agamemnon. Badisches Landesmuseum Karlsruhe (2018)
- Louise Schofield: Mykene: Geschichte und Mythos. Zabern (2009)
- Sigrid Deger-Jalkotzky und Dieter Hertel: Das mykenische Griechenland: Geschichte, Kultur, Stätten. C.H. Beck (2018)
- Angelos Chaniotis: Das antike Kreta. Beck'sche Reihe (2020)
- Karl-Wilhelm Welwei: Die griechische Frühzeit: 2000 bis 500 v.Chr. Beck'sche Reihe (2019)