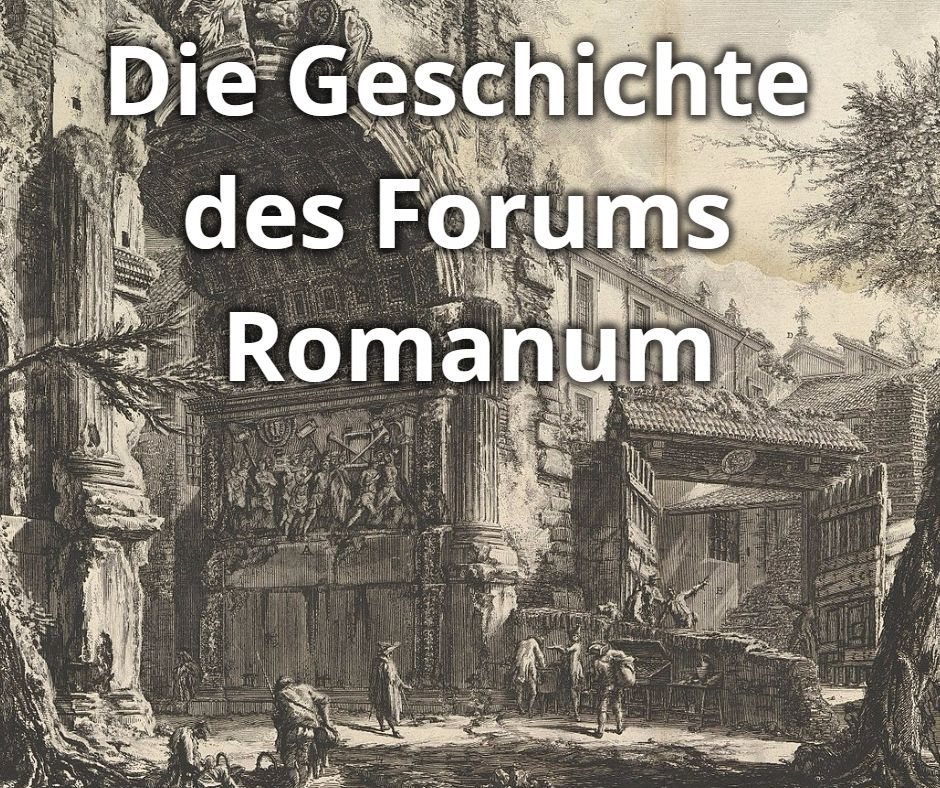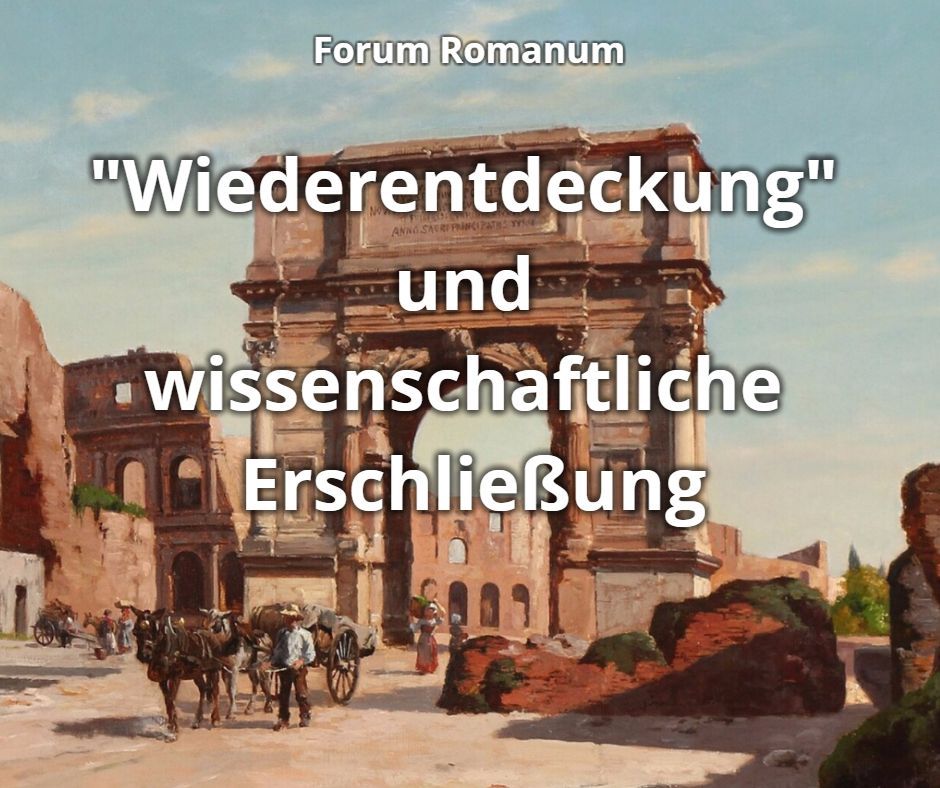Nach dem Niedergang des Weströmischen Reiches im Jahr 476 n. Chr. und der Herrschaft Theoderichs verfiel die Villa allmählich. Wie viele andere römische Landgüter könnte sie während der Kriege zwischen Ostgoten und Byzantinern beschädigt oder aufgegeben worden sein. Im Mittelalter gewann die Via Appia als Pilgerweg an Bedeutung, und entlang der Straße entstanden befestigte Bauernhöfe, Klöster und Türme. Möglicherweise wurden Teile der Villa weiterhin als landwirtschaftliche Gebäude genutzt. Bereits in mittelalterlichen Quellen taucht die Bezeichnung „Roma Vecchia“ auf – ein Hinweis darauf, dass die Ruinen damals noch imposant wirkten und als Überreste einer „verlorenen Stadt“ galten. Mit der Renaissance erwachte das Interesse an antiken Stätten erneut. Adelige und Päpste begannen gezielt nach Kunstwerken zu suchen, sodass vermutlich erste Raubgrabungen in der Villa stattfanden. Gleichzeitig wurde das Gelände weiterhin landwirtschaftlich genutzt.
Die Villa der Quintilier

Die Villa dei Quintili an der Via Appia Antica, in der Frühen Neuzeit oft „Roma Vecchia“ genannt, gehörte im Zeitalter der Grand Tour zu den bekannteren antiken Stätten im Umland Roms. Ihre ausgedehnten Ruinen wurden von spezialisierten Reisenden, Zeichnern und Antikenkennern besucht, die sich für römische Villenarchitektur interessierten. In dieser Zeit fanden dort Ausgrabungen und Antikenverkäufe statt, bei denen Skulpturen und andere Funde in vatikanische und private europäische Sammlungen gelangten. Die Verbreitung von Zeichnungen und die Präsentation einzelner Stücke in Museen trugen zur zeitgenössischen Wahrnehmung römischer Villenkultur bei.
Um das Jahr 150 n. Chr. errichteten die Brüder Sextus Quintilius Valerius Maximus und Sextus Quintilius Condianus dieses imposante Anwesen. (Die Identität der Eigentümer wurde durch eingravierte Namen auf Bleirohren festgestellt.) Beide gehörten zu den einflussreichsten Persönlichkeiten ihrer Zeit und bekleideten im Jahr 151 n. Chr. das Amt des Konsuls. Nach ihrer Ermordung im Jahr 182 n. Chr. auf Befehl von Kaiser Commodus, der sie der Verschwörung beschuldigte, ging das Anwesen in dessen Besitz über. Commodus nutzte und erweiterte die Villa als persönliche Residenz. In den folgenden Jahrhunderten wurde das Anwesen auch von anderen Kaisern genutzt. Zahlreiche Umbauten und Restaurierungen lassen sich bis ins 3. Jahrhundert zurückverfolgen, etwa unter Kaiser Tacitus. Auch in den darauffolgenden Jahrhunderten behielt die Villa ihre Bedeutung als eine der herausragendsten römischen Residenzen. Ihre Nutzung kann bis ins 6. Jahrhundert belegt werden, wie Ziegelstempel aus der Zeit des Theoderichs zeigen.


Franz Schreyer: Römische Landschaft. 1890. © Bild: Wikimedia Commons
Die systematische archäologische Erschließung der Villa der Quintilier begann erst im 18. Jahrhundert mit der Grand Tour und der wachsenden Nachfrage nach antiken Statuen für europäische Sammlungen. 1776 führte der Maler und Kunsthändler Gavin Hamilton erste Ausgrabungen durch, die den imperialen Charakter des Anwesens offenbarten. Dabei entdeckte er mehrere bedeutende Marmorskulpturen, darunter den schlafenden Adonis, der später ins Britische Museum gelangte, sowie ein großes Marmorrelief des Asklepios, das in das Lansdowne House in London überführt wurde. Zwischen 1783 und 1792 veranlasste Papst Pius VI. weitere systematische Ausgrabungen, um die Bestände des von seinem Vorgänger Clemens XIV. gegründeten Pio-Clementino-Museums zu erweitern. In dieser Zeit wurden einige der bekanntesten Skulpturen entdeckt, darunter die sogenannte Braschi-Aphrodite und zwei Darstellungen des Jungen mit der Gans. Mit dem Übergang des Anwesens an die einflussreiche Familie Torlonia im Jahr 1797 gewannen die Ausgrabungen erneut an Intensität – diesmal mit dem Ziel, die private Sammlung der Familie zu bereichern.
Nach der Einigung Italiens im 19. Jahrhundert rückte die Villa verstärkt in den Fokus archäologischer Forschung und Restaurierung. Zwischen 1899 und 1906 wurde der Standort von Thomas Ashby topographisch erfasst, vermessen und fotografiert. Eine der ersten bedeutenden Restaurierungen betraf das Nymphäum der Villa an der Via Appia. In den 1920er Jahren führten Zufallsfunde zu bedeutenden Entdeckungen. Zwischen 2002 und 2009 brachten umfangreiche Grabungskampagnen Teile der Portikusgärten, des Empfangsbereichs sowie des Tepidariums zwischen Calidarium und Frigidarium ans Licht. Zudem wurde der fast 300 Meter lange Xystus zwischen der Via Appia und dem zentralen Bereich freigelegt. Ein herausragender Fund gelang 2018 mit der Entdeckung eines aufwendig gestalteten Weinkellers mit angeschlossenem Triklinium.

Heute ist die Villa der Quintilier eine bedeutende archäologische Stätte, die für Besucher zugänglich ist. 2011 diente sie als Drehort für Woody Allens Film To Rome with Love, in dem ihre imposante Architektur als Kulisse für die römische Thermenkultur genutzt wurde.
RUNDGANG
Die Zisterne „Piranesi“
Das kreisförmige Gebäude mit einem Durchmesser von 29 Metern (ca. 100 römische Fuß), von dem noch Reste des römischen Betons mit Basalteinlagerungen erhalten sind, ist eine Zisterne aus dem 2. Jahrhundert n. Chr. Sie besteht aus sechs parallelen, miteinander verbundenen Räumen, die von Tonnengewölben überdacht sind. Im Inneren sind noch Überreste des wasserfesten Putzes erhalten. Zwischen dem 16. und 17. Jahrhundert wurde die Zisterne umgebaut und als Unterschlupf für Tiere genutzt. Dafür wurden drei Öffnungen an der Westseite geschaffen. Die Zisterne wurde zusammen mit den großen Baderäumen der Villa von Landschaftsmalern und Zeichnern der römischen Campagna dargestellt. Eine Radierung des Architekten Giovan Battista Piranesi zeigt den Grundriss und die Fassade des Gebäudes – daher erhielt die Zisterne ihren Namen.
Die Philosophensäle
Während der Ausgrabungen in den Jahren 2017–18 entlang der Nordseite der Nordportikus wurden eine Reihe prächtig dekorierter Räume freigelegt, von denen nur wenige Überreste erhalten sind. Die Entdeckung einer Porträtbüste eines griechischen Philosophen der epikureischen Schule in einem dieser Räume – eine römische Kopie aus dem 2. Jahrhundert n. Chr. nach einem griechischen Original – sowie die bereits Ende des 18. Jahrhunderts in derselben Gegend gefundenen Büsten von Sokrates und Epikur lassen vermuten, dass diese Räume der philosophischen Spekulation und Meditation dienten. Die Räume stammen aus der hadrianischen Zeit und wurden offenbar auf einer bereits bestehenden Wohnstruktur errichtet. Diese lässt sich, anhand der in opus reticulatum ausgeführten Mauern sowie eines Brunnens aus großen Peperinoblöcken mit einer Travertinumrandung, in die republikanische Epoche (3.–2. Jahrhundert v. Chr.) datieren.

Das Nymphäum
Das an der Via Appia gelegene Nymphäum wurde unter Kaiser Commodus errichtet, als dieser in den Besitz des Wohnkomplexes kam. Die monumentale Brunnenanlage zeichnete sich durch eine eindrucksvolle Ausstattung mit Statuen und Skulpturengruppen aus. Hinter der Fassade befanden sich Zisternen, aus denen das Wasser in kunstvoll gestaltete Becken floss, die mit Marmorplatten und Mosaiken verziert waren. Das Gebäude war für die Reisenden auf der Via Appia gut sichtbar und wurde durch eine große Öffnung mit vier Säulen markiert, von denen heute noch drei erhalten sind. Eine dieser Säulen wurde bei der Restaurierung zu Beginn des 20. Jahrhunderts wieder auf ihren ursprünglichen Sockel gestellt, der bereits im mittelalterlichen Mauerwerk wiederverwendet worden war. Ein Durchgang auf der rechten (südöstlichen) Seite verband die monumentale Front des Nymphäums mit einem langen, überdachten Portikus, der an den weitläufigen südlichen Garten (den südlichen Xystus) grenzte.
Im Mittelalter wurde das Nymphäum teilweise in eine militärische Befestigungsanlage (Castrum) integriert. Ein Turm und ein Balkon, der einen Blick auf den Garten der Villa bietet, gehören zu den erhaltenen Überresten dieser Wehranlage. Im Inneren des Bauwerks befand sich auf der oberen Ebene ein offener Hof, umgeben von überdachten Räumen, die vermutlich als Unterkünfte für die Bewohner der Anlage dienten. Mit dem Ende des 15. Jahrhunderts änderte sich die Nutzung des Areals erneut. In dieser Zeit wurde dort eine handwerkliche Einrichtung eingerichtet, möglicherweise eine Wäscherei. Diese Annahme stützt sich auf archäologische Funde von Wasserbecken und kleinen Sammelbecken, die für die Wasseraufbereitung genutzt wurden. Die neuen Strukturen wurden auf einem höheren Niveau als die römischen Gebäude errichtet, wobei sie deren Fundamente teilweise wiederverwendeten. Die mutmaßliche Wäscherei war Teil eines größeren landwirtschaftlichen oder gewerblichen Anwesens, das sich über den Gartenbereich erstreckte. Dieses Anwesen war durch mächtige Umfassungsmauern begrenzt, die entlang der Via Appia und des Gartens verliefen. Neben der möglichen Wäscherei wurden auch weitere Gebäude errichtet, darunter einige in der Nähe der großen Zisterne, was auf eine kontinuierliche Nutzung des Areals bis in die frühe Neuzeit hindeutet.
Der südliche Xystus
Der südliche Xystus war ein überdachter Säulengang, der sich entlang des weitläufigen Gartens im Südwesten der Anlage erstreckte. Gemeinsam mit dem nördlichen Xystus, der vor allem dem Spaziergang diente, bildete er ein architektonisches Ensemble, das sowohl ästhetische als auch funktionale Zwecke erfüllte. Während der nördliche Portikus als Flanierweg genutzt wurde, diente der südliche Xystus vor allem sportlichen Aktivitäten wie dem Laufen und Aufwärmen. In unmittelbarer Nähe befanden sich zudem Sauna- und Massageräume, die auf die Nutzung als Trainings- und Erholungsbereich hinweisen. Errichtet wurde der Säulengang gegen Ende des 2. Jahrhunderts n. Chr. unter kaiserlicher Herrschaft. Seine Konstruktion ermöglichte es, auch bei schlechtem Wetter sportlichen Tätigkeiten nachzugehen. Darüber hinaus erfüllte der südliche Xystus eine wichtige infrastrukturelle Funktion: Er verband den Wohnbereich der Villa mit dem monumentalen Nymphäum an der Via Appia und diente gleichzeitig als Stütze für das Aquädukt, das die Anlage mit Wasser versorgte.
Ausgrabungen, die in den Jahren 2007–08 durchgeführt wurden, brachten einen beträchtlichen Teil der repräsentativen und privaten Bereiche der Villa ans Licht, die überwiegend ins 2. Jahrhundert n. Chr. datiert wird. Die genaue Chronologie der Bauphasen ist allerdings Gegenstand laufender Forschungen.

Empfangsbereich:
Dieser Sektor gilt als Kernbereich der Anlage, der möglicherweise bereits in der ersten Hälfte des 2. Jahrhunderts n. Chr. entstand und unter kaiserlichem Besitz erweitert und renoviert wurde. Zentral liegt ein
großer, gepflasterter Hof (A), der als repräsentativer Versammlungsraum genutzt wurde. Ein oktogonaler oder polygonaler Hauptraum könnte sich hier über die übrige Bebauung erhoben haben; seine genaue Funktion ist jedoch nicht abschließend geklärt. In der Nähe liegt ein
kreisförmiger Bau (F), dessen Funktion in der Forschung umstritten ist. Einige Fachleute halten ihn für eine kleine Arena oder einen Veranstaltungsort für Schaukämpfe – möglicherweise ließ Kaiser Commodus hier Gladiatorenspiele ausrichten, an denen er selbst teilnahm. Andere hingegen vermuten eine alternative Nutzung, etwa als Teil einer Gartenanlage oder eines architektonischen Zierbaus. Westlich dieses Bereiches lag ein großes, kreisförmiges Sommertriklinium, das ebenfalls Commodus zugeschrieben wird und zu einem
halbkreisförmigen Bau (R) führte. Manche deuten R als kleines Theater mit stufenförmigen Sitzreihen und einer Bühne, doch ist diese Funktion nicht zweifelsfrei belegt. Die angrenzenden, luxuriösen Räume zwischen R und den Thermen dienten vermutlich dem Empfang und der Unterbringung von Gästen.
Privater Wohnteil:
An der Rückseite des großen Hofes (A) befanden sich
Schlafräume (Cubicula) und eine kleine Latrine (B). Weitere
private Wohnräume (B) lagen auf den
Terrassenunterbauten (C), die hauptsächlich zwischen dem späten 2. und dem frühen 3. Jahrhundert n. Chr. entstanden. Diese Bereiche wurden vermutlich für Küchen und Lagerräume genutzt.
Die großen Bäder:
Die ausgedehnten Thermen, die vorrangig für Gäste vorgesehen waren, erfuhren ihre letzte bekannte Erweiterung unter Septimius Severus und Caracalla, wobei verstärkt Ziegelmauerwerk verwendet wurde. Das
Frigidarium (D) verfügte über zwei symmetrische, etwa 1,60 m tiefe Kaltwasserbecken. Bei Ausgrabungen (1998–2000) entdeckte man hier Fragmente eines kostbaren Marmorbodens. Zwischen dem Frigidarium und dem großen
Caldarium (E) lagen Umkleideräume, Massageräume sowie Warm- und Kaltwasserbecken des Tepidariums.
Der Circus:
Ein etwa 500 m langer Circus, der vermutlich für Wagenrennen unter Commodus angelegt wurde, liegt heute größtenteils unter Privatgrundstücken. Ob er nach dem Tod des Kaisers gezielt abgerissen oder lediglich im Laufe der Zeit verfiel, ist in der Forschung umstritten. Bei Ausgrabungen in den Jahren 2017–18 wurden jedoch Teile eines Westturms und die Startboxen (carceres) aufgedeckt, die als Relikte dieser Anlage gelten.

Ein großer halbkreisförmiger Raum, einst von einer Säulenhalle umgeben, führte in einen großzügigen runden Saal, der vermutlich als sommerliches Triklinium (Speisesaal) genutzt wurde. Von dort aus eröffnete sich ein privilegierter Blick auf das halbkreisförmige Bauwerk, das einige Forscher als kleines Theater mit stufenförmigen Sitzreihen und einer Bühne interpretieren.

Die dreistufigen, mit Marmorplatten bedeckten Sitzreihen könnten zu einem Theater aus der Zeit des Commodus gehört haben.

Der Korridor zwischen den Bädern und dem Theater hatte einen Mosaikboden mit kleinen, bunten Kreuzen. In der spätrömischen Epoche gab es dort einen Ofen zum Schmelzen und Recyceln von Glas. In einer Ecke wurden Stapel recyceltes Glas gefunden.
Der große Hof diente als Versammlungs- und Diskussionsort, vergleichbar mit einem kleinen Forum. Sein Pflaster aus Cipollino-Marmor ist noch gut erhalten. Die Überreste des großen Gebäudes mit Kuppeldach und vier offenen Eingängen könnten den achteckigen Hauptraum des Empfangsbereichs darstellen.

Der Unterbau der oberen Stockwerke der Villa beherbergte Heizöfen, Küchen und Lagerräume und wurde von einer Kanalisation sowie einer Wasserleitung durchzogen.
Das Frigidarium
Das Caldarium
Bei diesem Bauwerk könnte es sich um ein kleines Amphitheater gehandelt haben, das vermutlich für das Training und die Kämpfe von Gladiatoren errichtet wurde – möglicherweise auf Wunsch von Kaiser Commodus, der hier seine Ambitionen verfolgte. Mitte des 3. Jahrhunderts wurde das Gebäude in einen Viridarium, also einen Garten, umgewandelt, der einen kreisförmigen Korridor für Spaziergänge im Freien entlang der Südseite aufwies.
Höfe und Gärten, die von Säulengängen begrenzt wurden, verbanden die verschiedenen Bereiche der Villa mit den unteren Ebenen. Diese Flächen waren mit dekorativen Pflanzen und Wasserbecken mit Fontänen geschmückt, von denen ein quadratisches Beispiel erhalten ist.

Die Ausgrabungen von 2017–2018 brachten einen Weinproduktionskomplex aus der ersten Hälfte des 3. Jahrhunderts zutage, errichtet über den eingeebneten Überresten der Starttore (Carceres) des bereits erwähnten Circus. Im Produktionsbereich, der mit zwei Räumen verbunden war, in dem die Pressen standen, befand sich ein Becken zum Pressen der Trauben. Zudem wurde ein Bereich für die erste Lagerung und Verkostung des Weins entdeckt. Der mit Marmor verkleidete Weinkeller enthielt 16 Tonbehälter, die paarweise in acht wasserdicht ausgekleideten Becken untergebracht waren. Drei reich verzierte Bankettsäle mit kunstvollen architektonischen Elementen und polychromem Marmor mit geometrischen Mustern umgaben die Anlage auf der Nord-, Ost- und Westseite.
BILDNACHWEIS:
- Luigi Rossini: Rossini - viaggio pittoresco tav19 - veduta di Roma Vecchia. © Bild: Wikimedia Commons
- Franz Schreyer: Römische Landschaft. 1890. © Bild: Wikimedia Commons

Suchbegriff bei Google Maps:
Villa der Quintilier
BUCHEMPFEHLUNGEN
- Laura Aitken-Burt u.a.: Das alte Rom: Die visuelle Geschichte. Dorling Kindersley (2023)
- Jessica Maier u. a.: Rom - Zentrum der Welt: Die Geschichte der Stadt in Karten, Plänen und Veduten. Theiss in Herder (2022)
- Christoph Höcker: Reclams Städteführer Rom. Architektur und Kunst. Reclam (2020)
- Christoff Neumeister: Das antike Rom: Ein literarischer Stadtführer. Beck (2010)
- Henner von Hesberg: Römische Baukunst. Beck (2005)
- Jonathan Boardman: Rome: A Cultural History. Interlink Books (2007)
- Jon Coulston & Hazel Dodge: Ancient Rome: The Archaeology of the Eternal City. Oxford University School of Archaeology (2000)
- Marco Bussagli: Rome: Art and Architecture. Konemann (2010)
- Filippo Coarelli: Rom: Der archäologische Führer. WBG (2019)
- Ingemar König: Caput Mundi: Rom - Weltstadt der Antike. WBG (2009)
- Anton Henze: Kunstführer Rom. Reclam (1994)
- Heinz-Joachim Fischer: Rom. Zweieinhalb Jahrtausende Geschichte, Kunst und Kultur der Ewigen Stadt. DuMont (2001)
- Karl-Joachim Hölkeskamp und
Elke Stein-Hölkeskamp (Hrsg.): Erinnerungsorte der Antike. Die römische Welt. Beck (2006)