Die Ursprünge von Vulci reichen bis ins 9. Jh. v. Chr. zurück. Der Reichtum an Metallressourcen im Fiora-Tal förderte das Aufblühen des lokalen Handwerks und trieb somit auch den Handel voran, insbesondere mit Sardinien. Die Stadt, die berühmt war für die Handwerkskunst seiner Bewohner, entwickelte sich zudem zu einem bedeutenden Zentrum für den Import von veredelter attischer Keramik, wertvollem orientalischem Balsam und Schmuck in außergewöhnlichen Formen, wie zahlreiche griechische und etruskische Kunstwerke aus den Gräbern in zahlreichen Museen der Welt belegen. (Foto: eine in Vulci gefundene Vase aus dem 5. Jh. v. Chr. Etruskische Sammlung in den Vatikanischen Museen. Bild: © Wikimedia Commons.) Der Wohlstand von Vulci gründete sich zudem auf die Kontrolle über die fruchtbaren landwirtschaftlichen Flächen der Region sowie den Zugang zu bedeutenden Handelsrouten, die den Austausch mit griechischen und phönizischen Städten ermöglichten.
Der archäologische Naturpark Vulci
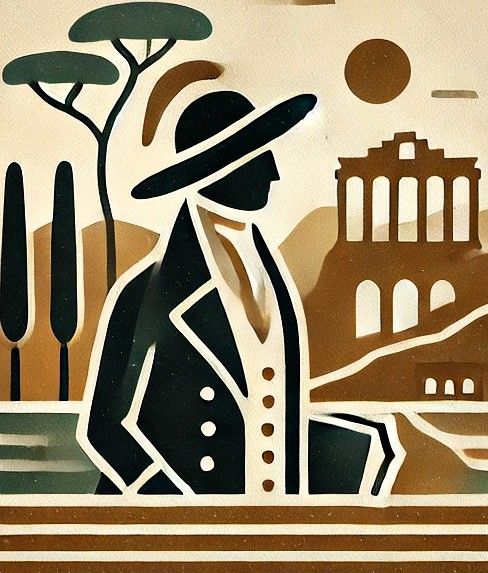
Mit den spektakulären Gräberfunden ab den 1820er-Jahren entwickelte sich Vulci von einem unscheinbaren Landstrich zu einem Anziehungspunkt für Archäologen, Kunsthistoriker und Kunstsammler aus ganz Europa. Besonders die Entdeckung der reich ausgestatteten etruskischen Nekropolen zog zahlreiche Forscher und Abenteurer an. Einer der ersten war Lucien Bonaparte, Bruder Napoleons, der in der Region lebte und selbst Grabungen organisierte – oft mit Blick auf den lukrativen Kunstmarkt. Später reiste der britische Diplomat und Forscher George Dennis nach Vulci und dokumentierte die Funde in seinem berühmten Werk "The Cities and Cemeteries of Etruria" (1848). Der bedeutendste Fund gelang schließlich Alessandro François, der 1857 die heute berühmte Tomba François entdeckte – ein Grab mit einzigartigen etruskischen Fresken. Diese Entdeckung machte Vulci endgültig zu einem Hotspot der etruskischen Forschung und lockte auch Vertreter großer europäischer Museen an. Zahlreiche Fundstücke aus Vulci gelangten so nach London, Paris, Berlin und Rom – und prägten das europäische Bild der geheimnisvollen Etrusker nachhaltig.

Nach der Eroberung durch die Römer im 4. Jh. v. Chr. wurde Vulci zu einem wichtigen römischen Außenposten. Aus dieser Zeit sind noch einige römische Bauten erhalten. Zu sehen sind unter anderem die Ruinen einer luxuriösen römischen Privatvilla und eines Mithras-Tempels aus dem 3. Jh. n. Chr.
Die Vulci gehörten zu den legendären zwölf Völkern der etruskischen Zivilisation, die zur Wahrung ihrer Interessen den Zwölfstädtebund gründeten. Obwohl der 8 km vom Tyrrhenischen Meer entfernte Stadtstaat eine führende Rolle in dieser politischen und religiösen Vereinigung spielte, wird er in der antiken Literatur aber nur selten erwähnt. Die Geschichte Vulcis lässt sich daher fast ausschließlich anhand archäologischer Ausgrabungen rekonstruieren.
Die etruskischen Gräber von Vulci, wie etwa die „Tomba della Cuccumella“, ein monumentales Grab aus dem 6. Jh. v. Chr., das besonders für seine Größe und ungewöhnliche Bauweise bekannt ist, das berühmte „Grab der Sphinx“ oder das „Grab der Reliefs“, zeugen von der Bedeutung der Stadt und dem Reichtum ihrer Bewohner. Diese Gräber sind bekannt für ihre kunstvollen Fresken, Skulpturen und Grabbeigaben, die einen Einblick in das Leben, die Religion und die Bräuche der Etrusker geben.
Im 4. Jh. v. Chr. geriet Vulci wie viele andere etruskische Städte in Konflikt mit der expandierenden römischen Republik. Nach mehreren Schlachten und Auseinandersetzungen verlor Vulci schließlich 280 v. Chr. seine Unabhängigkeit und wurde in das Römische Reich eingegliedert. Die Stadt verlor nach und nach an Bedeutung, da Rom und andere Städte im römischen Kernland an Einfluss gewannen.

Das Westtor
Der imposante Westeingang der antiken Stadt Vulci wurde in den Jahren 1996 bis 2003 bei Ausgrabungen freigelegt. Ursprünglich war die Stadt vermutlich durch einen in den Fels gehauenen Graben gesichert, der später durch eine beeindruckende Festungsmauer ersetzt wurde. Diese Mauer, bestehend aus riesigen quadratischen Blöcken aus rotem Tuffstein, wurde in der zweiten Hälfte des vierten Jhs.v. Chr. errichtet.
Zu Beginn des 3. Jhs. v. Chr., angesichts der drohenden Gefahr durch die römische Armee, gestalteten die Etrusker den Westeingang um. Sie errichteten unmittelbar vor dem Tor ein massives dreieckiges „Avant-Corps“ aus roten Tuffsteinblöcken, das den Zugang für Feinde erschwerte.

Dieses gewaltige Hindernis zwang die Angreifer, sich aufzuteilen, und machte es ihnen sowie ihren Belagerungsmaschinen nahezu unmöglich, in die Stadt vorzudringen. Während die Eindringlinge hier aufgehalten wurden, gewannen die Verteidiger von Vulci wertvolle Zeit, um sich zu organisieren und die Feinde von den oberen Mauern aus anzugreifen.
Der Tempio Grande
Der Große Tempel von Vulci stand auf einem 42,6 Meter langen und 28 Meter breiten Podium, das aus sechs übereinanderliegenden Schichten von Tuffsteinblöcken bestand. Der Tempel selbst maß 36 Meter in der Länge und 24 Meter in der Breite. Alle vier Seiten des Gebäudes waren von Säulenreihen umgeben: vier Säulen an der Rückseite, eine Doppelreihe von vier Säulen an der Vorderseite und jeweils sechs Säulen an den Seiten. Diese Säulen, die etwa 8,2 Meter hoch waren, trugen das Dach des Tempels. Sowohl die Säulen als auch das Dach bestanden aus Holz, wobei das Dach vermutlich mit Statuen verziert war.
Im Inneren des Tempels befand sich eine Cella (Raum) mit den Maßen 10 Meter mal 15 Meter. In dieser Cella stand eine Statue, vermutlich der Gottheit Minerva, der der Tempel geweiht war. Die Außengiebel des Tempels waren mit Darstellungen unbekannter Themen geschmückt. Der Zugang zum Tempel erfolgte über eine breite Treppe.

Diese Beschreibung bezieht sich auf die erste Bauphase des Tempels, die auf das späte 6. Jh. v. Chr. datiert wird. In den folgenden Jahrhunderten wurden weitere Veränderungen vorgenommen, vermutlich auf Veranlassung von Kaiser Augustus. Bei der letzten Erweiterung wurde die Basis des Tempels vergrößert, und die ursprünglich aus Holz gefertigten Bauteile wurden durch Mauerwerk ersetzt.
Der neu entdeckte Tempel
Im Rahmen des im Jahr 2020 gestarteten Projekts »Vulci Cityscape«, bei dem die Besiedlungsstrategien und urbanistischen Strukturen der Stadt Vulci aufgearbeitet werden, ist es Forschern der Universitäten Freiburg und Mainz gelungen, direkt neben dem Tempio Grande, der bereits 1950 entdeckt wurde, einen zweiten Tempel freizulegen. Nach ersten Untersuchungen der Schichten des Fundaments der bislang ausgegrabenen nordöstlichen Ecke des Tempels und den darin gefundenen Objekten datieren die Archäologen den Bau des Tempels gegen Ende des sechsten oder Anfang des fünften Jahrhunderts vor Christus. Der neue Tempel hat ungefähr die gleichen Abmessungen und eine ähnliche Ausrichtung wie der benachbarte Tempio Grande, der zeitgleich in archaischer Zeit erbaut wurde.
Tombe del Fontanile
Dieser Grabkomplex, der „nahe einer Quelle“ zwischen 1928 und 1931 freigelegt wurde, gehört zu einem ausgedehnten vorstädtischen Gräberfeld, das vom späten 8. bis zum 5. Jahrhundert v. Chr. genutzt wurde. In dieser Epoche gab es in Vulci Kammergräber, die hauptsächlich aus einem in den Fels gehauenen Raum mit umlaufender Bank bestanden, zu dem ein kurzer Dromos führte. Von den Gräbern sind heute nur sieben sichtbar.
Das Grab der Sphinx
Im Rahmen der im November 2011 gestarteten Ausgrabungskampagne wurden 25 Gräber freigelegt, darunter das sogenannte Sphinx-Grab, das auf das 6. Jh. v. Chr. datiert wird. Der fast 27 Meter lange Dromos dieses Grabes ist ein eindrucksvolles Zeugnis für den hohen Status der Familie, die es errichten ließ.

Vom Dromos aus betritt man ein versenktes, rechteckiges Vestibül mit offenem Himmel, das von mehreren Eingängen zu den Grabkammern flankiert wird. Die Decken der Grabkammern sind kunstvoll ausgeführt; einige imitieren mit ihrem schrägen Verlauf die Holzstrukturen traditioneller Wohnhäuser.
Bei den Ausgrabungen des Vestibüls entdeckten Archäologen eine Sphinx, die einen löwenartigen Körper, ausgebreitete Raubvogelflügel und ein menschliches Gesicht darstellt (datierbar auf 560-550 v. Chr.). Diese kunstvoll gearbeitete Skulptur aus Nenfro war vermutlich nicht Teil der ursprünglichen Grabdekoration, sondern gelangte in den Dromos, als dieser mit Erde aufgefüllt wurde. Statuen aus Nenfro waren seit 600 v. Chr. charakteristisch für das künstlerische Umfeld in der Region um Vulci und blieben einzigartig in Etrurien. Etwa ein Jahrhundert lang produzierten die Werkstätten von Vulci Sphinxe, Löwen, Panther, Widder, Zentauren und Seeungeheuer aus Nenfro und anderen vulkanischen Steinen. Diese Statuen dienten zunächst als Schutz vor bösen Einflüssen, entwickelten sich aber später zu „Wächtern“, die den Frieden der Toten bewahren sollten.
Die Tomba François
Die 1857 von den Archäologen Alessandro François und Adolphe Noël des Vergers in der Nähe des antiken Vulci entdeckte Grabanlage ist für ihre Wandmalereien bekannt, die zu den bedeutendsten Kunstwerken der etruskischen Kultur zählen. Das Grab wurde im 4. Jh. v. Chr. für eine adlige etruskische Familie errichtet, in einer Zeit, als Vulci nach der Eroberung im Jahr 396 v. Chr. bereits unter römischer Herrschaft stand.
Das Grab kann ausschließlich im Rahmen einer vorher gebuchten Führung besichtigt werden (Informationen hierzu erhalten Sie an der Kasse des Archäologischen und Naturparks Vulci, Telefon: +39.0766.031556, E-Mail: info@vulci.it).
Es verfügt über einen langen Dromos, der in eine Hauptgrabkammer führt. Hinter dieser befinden sich eine weitere Grabkammer und neun kleinere Kammern. Der Hauptraum enthält einen Sarkophag und ist mit kunstvoll gestalteten Fresken geschmückt.
Bald nach ihrer Entdeckung wurden die Fresken aus dem Grab entfernt und im Museum des Prinzen Torlona aufbewahrt. Seit 1946 sind sie Teil der Torlona-Sammlung in der privaten Villa Albani. Im Grab befinden sich Kopien der Kunstwerke.

Der Freskenzyklus vereint Themen aus der griechischen Mythologie mit Motiven der lokalen Heldensagen, wobei der Schwerpunkt auf einem deutlich antirömischen Kontext liegt. Die Szenen werden gegenübergestellt, um die Konzepte von Rache und Erlösung zu verdeutlichen. Die Fresken scheinen sich insbesondere auf die Kriege zwischen den Etruskern und den Römern zu beziehen, wobei die Römer in einem negativen Licht dargestellt werden. Darüber hinaus nehmen sie auch Bezug auf Kämpfe zwischen verschiedenen etruskischen Städten. Auf dem Bild ist auch Mastarna zu sehen, den Kaiser Claudius mit Servius Tullius, dem sechsten König Roms, gleichsetzte. Bild: © Wikimedia Commons
Das antike Siedlungsgebiet ist bisher deutlich weniger erforscht als die etruskischen Gräber in der Umgebung. Zu den ausgegrabenen Strukturen zählen eine gepflasterte römische Straße aus dem 2. Jh. v. Chr., ein Abschnitt der Stadtmauer aus der hellenistischen Epoche, ein großes Privathaus aus der Zeit zwischen dem späten 2. und frühen 1. Jh. v. Chr. (bekannt als "Casa del Criptoportico"), ein Mithras-Tempel aus dem 3. Jh. n. Chr., eine kleine spätantike Basilika, ein Triumphbogen aus der Zeit um 100 v. Chr. sowie die römische Brücke Ponte dell'Abbadia.
Die römische Straße (Decumanus)

Die Casa del Criptoportico
Das Haus des Kryptoporticus, das in der zweiten Hälfte der 1950er Jahre freigelegt wurde, ist ein imposantes Privathaus. Es wurde auf bereits bestehenden etruskischen Strukturen errichtet, ist 3.300 Quadratmeter groß und besteht aus drei Hauptbereichen: dem öffentlichen Bereich, dem privaten Bereich und den Bädern. Einer der Eigentümer dieses riesigen Anwesens war Marcus Vinicius, möglicherweise der Schwiegersohn des berühmten Generals Germanicus, dem Enkel von Augustus, der die Standarten der römischen Legionen zurückeroberte, die im Jahr 9 n. Chr. in der Schlacht im Teutoburger Wald verloren gingen.

Es handelt sich um eine große und prächtige private Residenz, die im klassischen Stil römischer Adelshäuser erbaut wurde (Domus mit Atrium und Peristyl). Ihre früheste Phase war das späte 2. und frühe 1. Jh. v. Chr. In augusteischer Zeit wurde umfangreich renoviert.

Der Kryptoportikus, ein unterirdisch gelegener Gewölbegang, ist über einen östlich des Peristyls gelegenen Korridor erreichbar. Dieser unterirdische Raum wurde durch 18 Fenster, die auf Höhe des darüber liegenden Gartens lagen, belüftet und erhellt. Die Hauptfunktion des Kryptoportikus bestand darin, Produkte wie Wein und Öl, die spezielle Lagerbedingungen erforderten, zu konservieren.
Das Mithräum
1975 fand man in einem Bereich eines Wohnhauses einen Tempel des Mithras-Kultes. Der rechteckige Kultraum hatte ein Tonnengewölbe.

In der Mitte des langen Korridors steht ein kleiner, noch gut erhaltener Altar, der einst für Opferungen genutzt wurde. Dieser Altar besteht aus Nenfro-Stein und diente wahrscheinlich dazu, kleine Tiere zu opfern. In derselben Umgebung wurden mehrere Statuen aus dem 3. Jh. n. Chr. entdeckt, darunter eine Statue von Cautes, einer fackeltragenden Gestalt, die als Begleiter des Gottes Mithras gilt, sowie zwei Statuen von Mithras, die den Stier tötet. Die größere der beiden Mithras-Statuen befand sich vor dem Altar, während die kleinere in einer Nische in der rechten Wand untergebracht war. Beide Statuen wurden kopflos vorgefunden, was darauf zurückzuführen ist, dass Christen nach 380 n. Chr. diese Kultstätte plünderten und niederbrannten.
Der Triumphbogen des Publius Sulpicius Mundus
Im Jahr 2003 wurden auf der Westseite des Forum Romanum, entlang des Decumanus, die Fundamente eines Triumphbogens entdeckt. Zahlreiche Fragmente kamen dabei zum Vorschein, die eine Rekonstruktion des Bogens ermöglichten. Zudem wurde eine lange Inschrift gefunden, die den Bogen dem römischen Senator Publius Sulpicius Mundus widmete, der um 100 v. Chr. lebte.

Ein Gebäude aus dem 2. Jh. n. Chr.
Das rechteckige, nach Osten ausgerichtete Bauwerk stammt aus dem 2. Jh. n. Chr. Es verfügte an seiner Westseite über eine Apsis. Errichtet wurde es auf älteren Strukturen aus Tuffstein in opus quadratum, die vermutlich aus etruskischer Zeit stammen und noch teilweise an der Nord- und Ostseite zu erkennen sind. Der Innenraum war einst mit einem Boden aus Marmorplatten ausgelegt, deren Markierungen auf der Vorbereitungsschicht erhalten geblieben sind. Bisher konnten die Forscher nicht klären, welche Funktion dieses Gebäude hatte.

Eine spätantike Basilika

Die Ponte dell’Abbadia
Die Ponte dell'Abbadia, die um 90 v. Chr. erbaut wurde, steht auf den Fundamenten einer etruskischen Brücke und spannt sich in 30 Metern Höhe über den Fluss Fiora. Sie führt direkt zur mittelalterlichen Burg Castello dell’Abbadia, die einst ein Zisterzienserkloster war und heute das archäologische Museum von Vulci beherbergt.

Bild: © Wikimedia Commons
BILDNACHWEIS:
- Daderot: Exhibit in the Museo Gregoriano Etrusco - Vatican Museums. Bild: © Wikimedia Commons
- Le Musée absolu, Phaidon, 10-2012: Libération de Celio Vibenna, tombe François, Ponte Rotto, Italie.jpg. Bild: © Wikimedia Commons
- Steffen Schulz: The Roman Ponte dell'Abbadia in Vulci, Lazio, Italy. Bild: © Wikimedia Commons

Suchbegriff bei Google Maps:
Città Etrusco-Romana di Vulci
- Josef Durm: Die Baukunst der Etrusker. In: Handbuch der Architektur. Zweiter Band. Kröner (1905)
- Veronika Maasburg: Etrusker & Römer. Reiseziele, Entdeckungen, Rekonstruktionen. H+L (1998)
- Harald Haarmann: Die Anfänge Roms: Geschichte einer Mosaikkultur. Marix (2021)
- Friederike Bubenheimer-Erhart: Die Etrusker. Philipp von Zabern in Wissenschaftliche Buchgesellschaft (2014)
- Dirk Steuernagel: Die Etrusker: Ursprünge – Geschichte – Zivilisation. Marix (2020)
- Friedhelm Prayon: Die Etrusker: Jenseitsvorstellungen und Ahnenkult. Philipp von Zabern in Wissenschaftliche Buchgesellschaft (2006)
- Werner Rutishauser (Hrsg.): Etrusker: Antike Hochkultur im Schatten Roms. Philipp von Zabern in Wissenschaftliche Buchgesellschaft (2017)
- Stephan Steingräber: Antike Felsgräber: unter besonderer Berücksichtigung der etruskischen Felsgräbernekropolen. Philipp von Zabern in Wissenschaftliche Buchgesellschaft (2015)
- Niels Lobmann: Die Etrusker: Geschichte und Kultur einer antiken Supermacht. (2018)
- Luciana Aigner-Foresti: Die Etrusker und das frühe Rom. Wissenschaftliche Buchgesellschaft (2009)
- Luciana Aigner-Foresti: Geschichte und Erbe der Etrusker. Kohlhammer (2023)
- Carlo Rosati: Die Etrusker und ihre Hohlwege: Geschichte, Symbolik und Legende. Paulsen (2018)
- Stephan Steingräber: Orvieto. Zabern (2010)
- Margarete Demus-Quatember: Etruskische Grabarchitektur : Typologie und Ursprungsfragen. Grimm (1958)
- Michael Grant: Rätselhafte Etrusker : Porträt einer versunkenen Kultur. Weltbild (1990)
- Florian Knauß (Hrsg.): Die Etrusker : von Villanova bis Rom. Nünnerich-Asmus (2015)
- Sybille Haynes: Kulturgeschichte der Etrusker. von Zabern (2005)
- Giovannangelo Camporeale: Die Etrusker : Geschichte und Kultur. Artemis & Winkler (2003)
- Otto Wilhelm von Vacano: Die Etrusker : Werden und geistige Welt. Kohlhammer (1955)
- Reinhard Herbig: Götter und Dämonen der Etrusker. von Zabern (1965)




