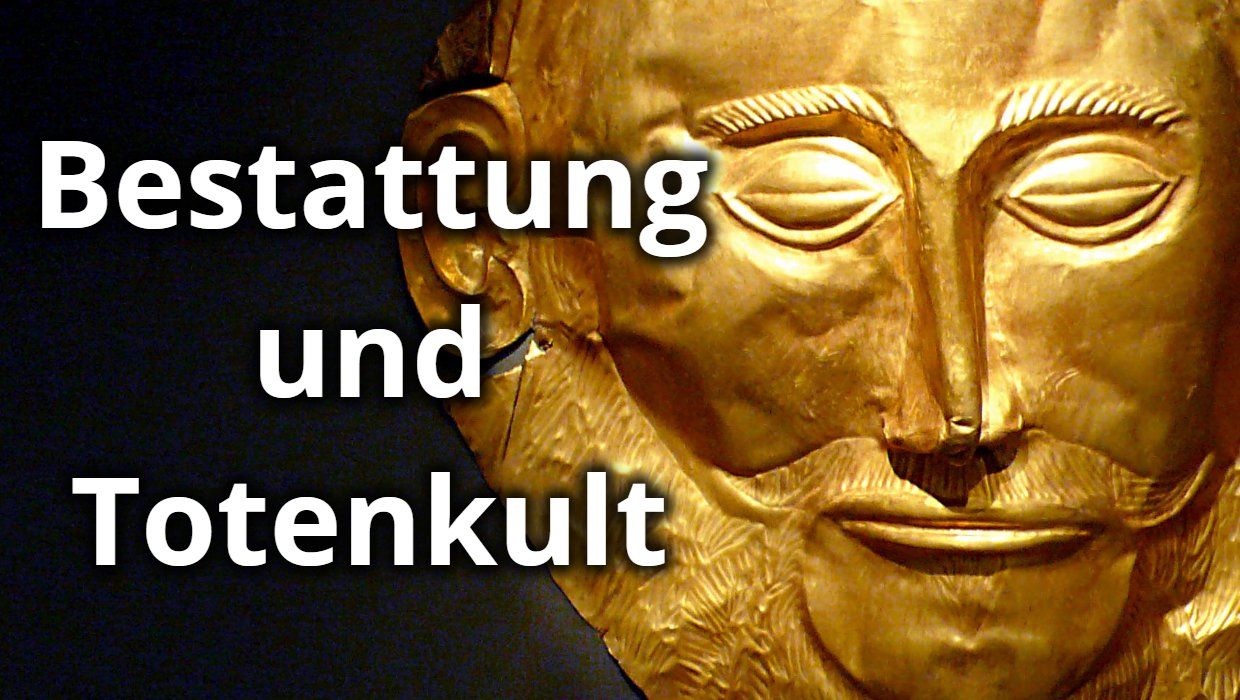Vielen Antikefans ist der Palast von Malia vor allem deshalb ein Begriff, weil in einem Grabgebäude, das sich 500 m nördlich des Palastes befindet, ein ganz besonderes Meisterwerk der minoischen Kunst gefunden wurde. Bei dem in der Altpalastzeit (1800 – 1700 v. Chr.) hergestellten Schmuckstück, das unter dem Namen „Bienen von Malia“ eine gewisse Berühmtheit erlangt hat, handelt es sich um einen goldenen Anhänger, der eine Breite von 4,9 cm und eine Höhe von 4,6 cm hat. Der Künstler hat dabei zwei Bienen bzw. Wespen dargestellt, die an einem Honigtropfen saugen. Die Körper der Bienen sind um eine Wabe gekrümmt. Darüber befindet sich ein Drahtkäfig, in dem eine kleine Goldkugel eingearbeitet ist. An den beiden Flügeln und am Berührungspunkt der beiden Stacheln hängt jeweils eine dünne Scheibe mit granuliertem Rand herab. Die kleinen Goldkügelchen, die nur an ihren Berührungspunkten miteinander verbunden sind, haben übrigens einen Durchmesser von nur 0,4 mm.
Der Palast von Malia und die Nekropole von Chrysolakkos


Besichtigung des Ausgrabungsgeländes: Vom Eingang kommend nähert man sich dem Palast über einen unregelmäßig gepflasterten Platz von etwa 100 m Länge, der sich vor der ehemaligen Westfassade des Bauwerks befand. Rechts geht es weiter zu Mauerfragmenten, die als Getreidespeicher interpretiert werden. Über den südlichen Eingang gelangt man zu dem 48 x 23 m großen Zentralhof (A) . An der sog. Pfeilerhalle vorbei führt der Weg dann weiter zum Nordeingang. Von dort aus sieht man schon die mit einem Schutzdach versehene, rätselhafte „Pfeilerkrypta“ (B). Etwas weiter vom Palastgelände entfernt befindet sich eine ebenfalls überdachte Ausgrabungsstätte, die als Quartier M bezeichnet wird.
Der von Prozessionsstraßen, die mit Platten aus hellem Kalkstein gepflastert waren, durchzogene Westhof liegt vor der Westfassade des Palastes. Die ehemals zweistöckige, monumentale Westfassade, die nur von einem Nebeneingang durchbrochen ist, bildet keine einheitliche Front. Sie weist vielmehr mehrere Vor- und Rücksprünge auf. Im Westflügel befanden sich Magazinräume und auch Räumlichkeiten, die für kultische und offizielle Anlässe genutzt wurden.
Etwas außerhalb der Südwestecke des Palastes befinden sich zwei Reihen von je vier nebeneinander liegenden runden Mauerfragmenten von je 4 m Durchmesser. Diese Anlagen erinnern an die Kouloures in Knossos. Über die Funktion dieser Anlagen wurden mehrere Theorien aufgestellt. Die am weitesten verbreitete Theorie besagt, dass es sich dabei um Getreidespeicher handelt, die dazu da waren, überschüssige Ernten zu lagern. Jeweils ein Mittelpfeiler trug das Dach.
Am Ende des Westflügels befindet sich eine selbständige Raumgruppe, die einen eigenen Eingang hatte. Besucher konnten so von außen in den dort untergebrachten kleinen Kultraum gelangen. Hier wurden zahlreiche Kultgegenstände gefunden.
An der Südseite des Palastes öffnet sich der repräsentative Südeingang, der wahrscheinlich bei kultischen Anlässen benutzt wurde. Vom Eingang führt ein breiter, mit einem besonders schönen Plattenbelag ausgestatteter Korridor zum Zentralhof.
Im Südflügel des Palastes, der vom Korridor des Südeingangs zugänglich war, waren – zumindest im Erdgeschoß – kleine Werkstätten untergebracht. Über den dort befindlichen Südosteingang konnte man direkt zum Zentralhof gelangen.
Der 48 x 23 m große Zentralhof ist ein Relikt aus dem Alten Palast. An einigen Stellen blieb sogar der originale Plattenbelag erhalten. Der Zentralhof bildete nicht nur den architektonischen Mittelpunkt der Palastanlage. Er war auch Zentrum des Palastlebens.

In der Mitte des Zentralhofes befindet sich eine Brandopferstelle aus der Zeit des Neueren Palastes. Zu sehen ist eine von einer Mauer umgebene Vertiefung mit vier Basen aus Lehm.

Im Westflügel sind (wie dies übrigens auch in Knossos der Fall ist) Räume untergebracht, die für kultische Handlungen vorgenommen wurden. Von besonderer Bedeutung dabei dürfte die sog. „Loggia“, die auch als Thronsaal gedeutet wird, gewesen sein. Der Eingang besaß einen Mittelpfeiler. Eine vierstufige Treppe führt zu einer etwas höher gelegenen, wahrscheinlich gedeckten „Loggia“, wo kultische Zeremonien abgehalten wurden. Vom Zentralhof aus konnten die Besucher die dortigen Vorgänge beobachten. Hinter der Loggia führt eine Treppe zwischen zwei Säulen zu einem kleinen Zimmer, der „Saal des Leoparden“ genannt wird. Dort wurden nämlich zahlreiche kostbare Funde gemacht. Unter anderem fand man hier die berühmte, mit einem springenden Leoparden geschmückte Kultaxt und ein ein Meter langes Bronzeschwert mit Verzierungen aus Gold und Bergkristall. Dahinter könnte sich ein Bad und ein Versammlungsraum für Priester befunden haben.

Der im Saal der Leoparden gefundene Kopf eines Zepters in Form eines Leoparden ist ein hervorragendes Werk neopalatischer Steinschnitzerei. Das aus dem 17. Jh. v. Chr. stammende Aufsatz für ein Zepter ist auf der einen Seite wie ein Leopard und auf der anderen Seite wie eine Axt geformt. Das Tier ist überaus plastisch und lebendig wiedergegeben. Dieses Kunstwerk, das man im Archäologischen Museum in Heraklion besichtigen kann, vereint die Symbole religiöser und politischer Macht der minoischen Könige . © Bild: Wikimedia Commons

Das große Treppenhaus südlich der Loggia führte vom Hof im das erste Obergeschoß, wo sich womöglich auch ein Kultraum befand.
Noch etwas weiter südlich befindet sich die sog. Pfeilerkrypta, die zwei mächtige Pfeiler besitzt. Mit großer Wahrscheinlichkeit war auch dieser Raum für kultische Handlungen bestimmt.

Die Westseite des Zentralhofes mündet im Süden in eine monumentale Treppe, von der noch 4 Stufen erhalten geblieben sind. Wie auch bei den „Theateranlagen“ der anderen minoischen Palästen dürften diese Treppen als Sitzreihen benutzt worden sein. © Bild: Wikimedia Commons
Neben dem Südende der Treppe befindet sich auf einem etwas erhöhten Podest der Kernos. Er wird so genannt, weil dieser runde Stein von 90 cm Durchmesser, der nahe seinem Rand 34 kleine Eintiefungen aufweist, einem Kernos (Opfergefäß) aus der klassischen Zeit ähnelt. In die kleinen Löcher wurden symbolische Opfergaben an die Götter gelegt. Eine Vertiefung ist dabei größer als die anderen und eine weitere wurde in der Mitte des Steins platziert.
Dem Ostflügel war zum Hof hin eine monumentale, 34 m lange Stoa vorgelagert. Auf einem Unterbau standen abwechselnd Steinpfeiler und Holzsäulen. Der Ostflügel bestand aus einer Gruppe von schmalen, langgestreckten Räumen (Ostmagazine). Jeder Raum besaß umlaufende Steinbänke, auf denen Vorratsgefäße aufgestellt wurden.
Auch der Nordfassade des Zentralhofes war eine Stoa vorgelagert, die jedoch nur Holzsäulen besaß. Hinter ihr liegt der Nordflügel. Die große Pfeilerhalle, von der noch die Basen sechs unterschiedlich großer Pfeiler zu sehen sind, fällt da sofort ins Auge. Vielleicht befand sich oberhalb dieses großen Raumes ein Saal, der für liturgische Bankette genutzt wurde.

Ein Durchgang verbindet den Zentralhof mit dem Nordhof, der von Magazingebäuden umgeben war.
Die zwei Meter hohen Pithoi wurden zum Aufbewahren von Getreide, Olivenöl oder anderen Flüssigkeiten verwendet.
Der Polythyron besteht aus einem System von Doppeltüren, deren Funktion noch nicht geklärt ist. Vielleicht handelt es sich dabei um ein architektonisches Element, das die Luftzirkulation in den Räumen begünstigt hat.

Nicht weit davon entfernt befindet sich ein etwas tiefer gelegenes kultisches Reinigungsbecken mit einem sechsstufigen Zugang und einem Vorraum.
Nördlich des Westhofes befindet sich die mit einem Schutzdach versehene „Pfeilerkrypta“. Dabei handelt es sich hauptsächlich um Kellerräume mit Steinbänken an den Wänden, deren Funktion nicht geklärt sind.
In der Umgebung des Palastes wurden weite Teile der den Palast umgebenden Stadt freigelegt, die wieder von einem großen Schutzdach von Witterungseinflüssen geschützt werden. Das als „Quartier M“ bezeichnete Areal nimmt eine Fläche von über 3000 m2 ein. Bei diesem aus der protopalatialen Periode (ca. 1900 – 1750 v. Chr.) stammenden Komplex handelt es sich um den größten und am besten erhaltenen dieser Zeit auf Kreta. In diesem Viertel wurden zwei große Gebäude und sieben kleinere um sie herum untersucht. In den Gebäuden A (ca. 840 m2) und B (ca. 540 m2), die weit größer als gewöhnliche Häuser sind, wurden den Palästen vergleichbare Bereiche identifiziert: Wohnräume, religiöse Räume, Hallen und Lagerräume. Diese großen Gebäude waren von sieben kleineren Gebäuden umgeben, von denen fünf als Handwerkerhäuser identifiziert wurden, darunter die eines Töpfers, eines Metallarbeiters und eines Siegelsteingraveurs.
Etwa 500 m nördlich des Palastes ist in der Nähe des Strandes eine Nekropole gefunden worden, bei der drei Bauphasen nachgewiesen werden konnten. Während der Frühminoischen Phase wurde ein als Chrysolakkos I bezeichnetes Gebäude errichtet. In der Altpalastzeit kam dann das Gebäude Chrysolakkos II dazu, das vermutlich der herrschenden Schicht von Malia als Begräbnisstätte diente. Es handelt sich dabei um ein Hausgrab, das eine Fläche von etwa 1150 m2 bedeckt. Dort fand man etwa 40 Räume, die zumindest teilweise für Bestattungen genutzt wurden. In einem dieser Räume fand man die berühmten Bienen von Malia.
BILDNACHWEIS
- Model of Malia Palace: Yu.Denisov. © Bild: Wikimedia Commons
- Final-handle of scepter, panther, axe, Malia, 1800-1700 BC. © Bild: Wikimedia Commons
- Malia, Kreta: Das Theaterareal des Palast von Malia. Schuppi. © Bild: Wikimedia Commons

Suchbegriff bei Google Maps:
BUCHEMPFEHLUNGEN
- Josef Fischer: Mykenische Paläste: Kunst und Kultur. Philipp von Zabern (2017)
- J. Lessley Fitton: Die Minoer. Theiss (2004)
- Zeit der Helden: die "dunklen Jahrhunderte" Griechenlands 1200 - 700 v. Chr. Badisches Landesmuseum Karlsruhe. Primus (2008)
- Götter und Helden der Bronzezeit. Europa im Zeitalter des Odysseus. Bonn: Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland (1999)
- Richard T. Neer: Kunst und Archäologie der griechischen Welt: Von den Anfängen bis zum Hellenismus. Philipp von Zabern (2013)
- Katarina Horst u.a.: Mykene. Die sagenhafte Welt des Agamemnon. Philipp von Zabern (2018)
- George E. Mylonas: Mykene. Ein Führer zu seinen Ruinen und seine Geschichte. Ekdotike Athenon ( 1993)
- Ingo Pini: Beiträge zur minoischen Gräberkunde. Deutsches Archäologisches Institut (1968)
- Hans Günter Buchholz: Ägäische Bronzezeit. Wissenschaftliche Buchgesellschaft (1987)
- Heinrich Schliemann: Bericht über meine Forschungen und Entdeckungen. Fachbuchverlag Dresden (2019)
- Mykene: Die sagenhafte Welt des Agamemnon. Badisches Landesmuseum Karlsruhe (2018)
- Louise Schofield: Mykene: Geschichte und Mythos. Zabern (2009)
- Sigrid Deger-Jalkotzky und Dieter Hertel: Das mykenische Griechenland: Geschichte, Kultur, Stätten. C.H. Beck (2018)
- Angelos Chaniotis: Das antike Kreta. Beck'sche Reihe (2020)
- Karl-Wilhelm Welwei: Die griechische Frühzeit: 2000 bis 500 v.Chr. Beck'sche Reihe (2019)